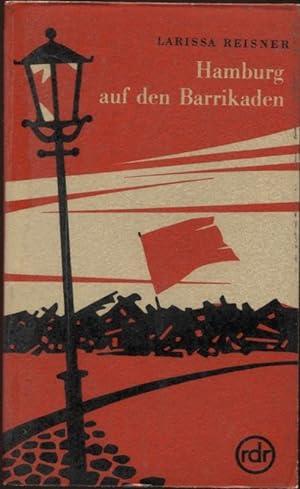Auf dem Blog hamburgeraufstand.noblogs.org wurde Larissa Reissners Werk "Hamburg auf den Barrikaden" veröffentlicht. Auch wir möchten dieses Werk an dieser Stelle teilen und verweisen für weitere Dokumente, Infos und Veranstaltungen nochmals auf den Blog.
HAMBURG AUF DEN BARRIKADEN
Erlebtes und Erhörtes aus dem Hamburger Aufstand 1923
Von Larissa Reissner
VORWORT
Der namenlose Held.
In einem Brief an die amerikanischen Arbeiter schreibt Lenin: „Auf je hundert unserer Fehler, von denen die Bourgeoisie und ihre Speichellecker (unsere Menschewiki und die Sozialrevolutionäre darunter) in die Welt hinausschreiben, kommen 10 000 große Heldenakte, die um so größer und um so heldenhafter sind, da sie einfach unscheinbar sind, sich im Alltag des Fabrikviertels oder des entlegenen Dorfes abspielen und von Menschen begangen werden, die nicht gewohnt sind (und auch keine Möglichkeit dazu haben) ihren Erfolg in die Welt hinaus zu trompeten.“
Das Hamburger Proletariat ist der namenlose Held dieser Erzählung. Es ist wahr: wenig wissen die breiten Massen selbst in Deutschland von der ruhmvollen Hamburger Episode der Oktobertage 1923. Nicht nur, daß, wie der Verfasser auf den ersten Seiten schreibt, „der Arbeiter in den Grenzen eines bürgerlichen Staates keine Geschichte hat“, daß, „die Liste seiner Helden das Standgericht und der Fabrikportier des menschewistischen Gewerkschaftsverbandes führen“ – nein, weiter über den Tod hinaus wird das verhaßte Andenken der Rebellen beschmutzt oder gänzlich erstickt – durch Verleumdungen oder durch Schweigen. Nachdem der Schlächter der französischen Kommune, Thiers, die Helden des Proletariats von Paris als „eine Handvoll Verbrecher“, als „Mörder“ bezeichnete, hat Friedrich Engels im Vorwort zu Karl Marx: „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ das Schicksal der proletarischen Kämpfer gekennzeichnet:
„Die ‚Mauer der Föderierten‘ auf dem Kirchhof Pére Lachaise, wo der letzte Massenmord vollzogen, steht noch heute, ein stummberedtes Zeugnis, welcher Raserei die herrschende Klasse fähig ist, sobald das Proletariat es wagt, für sein Recht einzutreten. Dann kamen die Massenverhaftungen, als die Abschlachtung aller sich als unmöglich erwies, die Erschießung von willkürlich aus den Reihen der Gefangenen herausgesuchten Schlachtopfern, die Abführung des Restes in große Lager, wo sie der Vorführung vor die Kriegsgerichte harrten.“
Die dem Tode entgangenen Helden der revolutionären Erhebungen der letzten Jahre werden überall von Kerker und Verfolgung bedroht. Auch die Helden von Hamburg schmachten im Zuchthause von Fuhlsbüttel oder sie werden von der Polizei verfolgt, durch das Land gehetzt. Von den Leiden der politischen Gefangenen erzählt eine immer breiter anwachsende Kerkerliteratur, die dem Klassengesicht der proletarischen Literatur der letzten Zeit das besondere Gepräge gibt, das düstere und zugleich aufreizende Gepräge einer unerhörten, maßlosen Unterdrückung und Knebelung der revolutionären Kräfte des Proletariats, seiner besten Vorkämpfer. Aber alle Unterdrückung und Knebelung konnte nicht verhindern, daß im Herzen des Proletariats der Wasserkante die lebendige Erinnerung an die Oktobertage wach geblieben ist, weil „der Hamburger Aufstand weder in militärischer noch politischer, noch moralischer Hinsicht besiegt war“. Und dieses starke Erlebnis eines offenen revolutionären Kampfes, in dem es brennt und blitzt von Aktivität, ließ hier ein Buch entstehen, das ganz einzigartig auch in literarischer Qualität inmitten der deutschen proletarischen Literatur ist.
Neuer Deutscher Verlag.
DIE BARRIKADE
I.
In großen Städten vergeht ein Aufstand spurlos. Eine Revolution muß groß und sieghaft sein, wenn die Spuren der Zerstörungen, ihre heroischen Wunden, die weißen Trichter der Kugeln an den Mauern, die mit den Pockennarben des Maschinengewehrfeuers bedeckt sind, sich einige Jahre lang erhalten sollen.
Nach zwei, drei Tagen, nach zwei, drei Wochen verschwindet – zusammen mit den von schmutzigen Regengüssen umspülten, mit einer Bajonettspitze von der Mauer abgerissenen Fetzen der Plakate – die kurze Erinnerung an den Straßenkampf, an das aufgewühlte Pflaster, an die Bäume, die, Brücken gleich, über die Flüsse der Straßen und die Bäche der Gassen hinübergeworfen waren.
Hinter den Schuldigen schlagen die Gefängnistore zu; aus den Fabriken hinausgeworfen, sind die Teilnehmer an einem Aufstande gezwungen, in einer anderen Stadt – in einem entfernten Viertel Arbeit zu suchen; nach der Niederlage verkriechen sich die Arbeitslosen in fernen namenlosen Winkeln – die Frauen schweigen, die Kinder leugnen, in ewiger Furcht vor den allzufreundlichen Fragen eines Spitzels, – und die Legende über die Tage des Aufstandes verweht, wird vergessen, übertönt von dem Lärm des wiederhergestellten Verkehrs, der wieder aufgenommenen Arbeit. Die neue Arbeiterschicht in den Fabriken tritt an die verlassenen Werkbänke, raunt sich eine Weile einige Namen und einige besonders geglückte Schüsse zu, – aber auch das vergeht.
Der Arbeiter hat in den Grenzen eines bürgerlichen Staates keine Geschichte; die Liste seiner Helden führen das Standgericht und der Fabrikportier aus dem menschewistischen Gewerkschafts-Verbande. Nachdem sie mit Waffen gesiegt hat, sucht die Bourgeoisie das verhaßte Andenken an die kürzlich erlebte Gefahr mit Vergessenheit zu ersticken.
Seit dem Hamburger Aufstand ist bereits über ein Jahr vergangen. Aber seltsam genug – sein Andenken will nicht weichen – obwohl die Spuren der Barrikaden sorgsam beseitigt sind und die Züge friedlich über die Dämme und Viadukte laufen, die der Verteidigung oder dem Angriff dienten, – Möven ruhen auf ihnen.
Drei standrechtliche Fleischmaschinen stecken die Teilnehmer der Straßenkämpfe in aller Eile in die Gefängnisse; Aerzte und Gefängnisaufseher haben schon längst die durch die Mißhandlungen bis zur Unkenntlichkeit entstellten Leichname an die Verwandten abgeliefert. Aber die Erinnerung an den tollkühnen Oktober will trotzdem nicht dem Alltag weichen. Es gibt in der alten Hansestadt Hamburg keine Kneipe, keine Arbeiterversammlung, keine proletarische Familie, wo die Namen der Teilnehmer nicht mit Stolz genannt, wo nicht mit unwillkürlicher Achtung von den erstaunlichen Szenen in den Straßen der Vorstädte gesprochen wird.
Die Erklärung für diese Hartnäckigkeit, mit der das Proletariat der Wasserkante die lebendige Erinnerung an die Oktobertage wach hält, liegt darin, daß der Hamburger Aufstand weder in militärischer, noch politischer, noch moralischer Hinsicht besiegt war. Es ist in den Massen nicht die tiefe Bitterkeit einer Niederlage geblieben.
Der anhaltende revolutionäre Prozeß, der sie im Oktober auf die Barrikaden warf, nahm am 24. kein Ende, als die gesamte Polizei und die Schwarzhundert-Garden der Marine-Division und der Reichswehr mobilisiert wurden, und auch nicht am 26., als kompakte Massen der Polizei, tausendköpfige Abteilungen der Kavallerie und Infanterie, eine Menge von Panzerwagen endlich in die revolutionären Vorstädte einbrachen, die schon einige Stunden vorher von den Arbeiter-Hundertschaften freiwillig verlassen wurden. Im Gegenteil, die Bewegung, die in den Oktobertagen zum Durchbruch kam, die sechzig Stunden über der Stadt herrschte, die den Gegner an allen Punkten schlug, wo er es wagte, zum Angriff gegen die geschickt angelegten Barrikaden überzugehen; eine Bewegung, die den Arbeitern nur zehn Tote und der Polizei und den Truppen Dutzende von Toten und Verwundeten kostete, – diese Bewegung hat ihre Kämpfer in aller Ruhe und Ordnung zurückgezogen, ihre Waffen gerettet und verborgen, die Verwundeten in eine sichere Unterkunft geschafft, – kurz, sie hat sich planmäßig zurückgezogen, sich in illegale Schlupfwinkel verkrochen, um sich bei dem ersten Ruf der reichsdeutschen Revolution wieder zu erheben.
Der Anfang der revolutionären Bewegung beginnt nicht im Oktober, sondern im August des Vorjahres, als Hamburg zu einer Arena von hartnäckigen und erbitterten Kämpfen für den Arbeitslohn, für den achtstündigen Arbeitstag, für die Entlohnung in Goldwährung, für eine ganze Reihe nicht nur ökonomischer, sondern auch rein politischer Forderungen wurde: Arbeiterregierung, Produktionskontrolle, usw. Diese gewerkschaftlichen Kämpfe waren begleitet von Streikausbrüchen und stürmischen Eruptionen des anwachsenden revolutionären Hasses, von der Demolierung der Lebensmittelläden, von einer harten Maßregelung der Streikbrecher und gelegentlicher Verprügelung der Polizei. Die Hamburger Arbeiterinnen haben sich in diesen Monaten besonders ausgezeichnet; im allgemeinen sind die Frauen einer großen Hafenstadt weitaus selbstständiger und politisch gereifter, als ihre Genossinnen in den meisten Industriezentren Deutschlands. Sie waren es, die im August des Vorjahres ihre Männer hinderten, die Arbeit in den streikenden Werften wiederaufzunehmen. Ihre lebendige Kette vermochten weder Polizeibajonette, noch kleinmütige Arbeiterhaufen, die bereit waren, jede Bedingung der Arbeitgeber anzunehmen, von dem Elbtunnel zu verdrängen und zu durchbrechen. Einer dieser Zusammenstöße endete mit der Entwaffnung und Verprügelung einer Polizei-Abteilung, zumal ihres Leutnants, der sie leitete und dafür im schmutzigen, kalten Elbwasser ein Bad nehmen mußte.
Begonnen im August, hat diese Bewegung nicht mit einem Zusammenbruch geendet – wie es die Bourgoisie ausposaunt – und auch nicht mit einer glänzenden militärischen Demonstration der Reichskräfte; diese Bewegung wird nur mit einem Siege oder einer Niederlage der gesamten Arbeiterklasse Deutschlands enden. In dieser Kontinuierlichkeit, in diesem steten und anhaltenden Anwachsen, das die Hamburger Genossen auszeichnet, liegt der grundlegende Unterschied des bewaffneten Aufstandes von dem sogenannten politischen „Putsch“.
Der „Putsch“ hat weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft; er ist entweder ein endgültiger Sieg oder eine ebensolche nicht wieder gutzumachende, hoffnungslose Niederlage. Wenn eine Revolution stark ist und von einer starken, kampffähigen Partei geleitet wird, – dann kann sie sich zurückziehen, ihre Federn wieder spannen, sich auch nach dem verzweifeltsten Durchbruchsversuch wieder zusammenrollen. Wenn das Proletariat schwach, politisch nicht trainiert, nicht gestählt ist, dann lebt es in der Hoffnung auf einen kurzen Stoß, auf einen blutigen, scharfen Ausbruch, aber zu einer anhaltenden Spannung ist es nicht fähig. Mag dieser kurze Stoß die größte Anspannung, die ungeheuerlichsten Opfer kosten, – die schlecht zusammengefügten lockeren Massen werden zu allem bereit sein, wenn eine starke Hoffnung auf einen vollen, endgültigen Sieg besteht. Wenn aber einem solchen Versuch, die Macht zu erobern, aus diesem oder jenem Grunde ein Mißerfolg folgt – dann zerfallen diese Massen, lösen sich aus jeder Organisation heraus, verstärken ihre Niederlage durch eine wütende Selbstkritik. Die regulären Stammtruppen der politisch gereiften Massen dagegen kehren nach einem Sturmangriff zu ihren alten Schützengräben der „Friedenszeit“ zurück, sie sind fähig, die langweilige, langsame Belagerungsarbeit, die Minierarbeiten des illegalen Kampfes und die alltäglichen kleinen Scharmützel wiederaufzunehmen. Der Hamburger Aufstand bietet – sowohl nach dem anhaltenden ihm vorangegangenen politischen Prozess, als auch, und das ganz besonders, nach der glänzenden Arbeit, die in den nächsten Tagen und Wochen nach seiner Liquidation geleistet wurde – ein klassisches Beispiel für einen echten revolutionären Aufstand, der die interessanteste Strategie der Straßenkämpfe und eines einzigartigen, idealen Rückzugs ausgearbeitet und in den Massen das Gefühl einer zweifellosen Ueberlegenheit über den Feind, das Bewußtsein des moralischen Sieges zurückgelassen hat.
Wir werden weiter unten die traurige Rolle beleuchten, die die Gewerkschaftsbürokratie und ihr rechter Flügel in den Oktobertagen gespielt haben. Der Verband „Vereinigung Republik“ – diese Leibgarde des Menschewismus – hat offen die Funktionen der Polizei in den ruhigeren Stadtgebieten übernommen und ihr auf diese Weise die Möglichkeit gegeben, ihre Kräfte auf die Unterdrückung von Hamm und Schiffbek zu konzentrieren. Davon wird weiter unten noch die Rede sein, – wir wollen hier nur bemerken, daß all diese kriegerischen Taten der Sozialdemokratie dazu geführt haben, daß vor den Türen ihrer Registrationsbüros sich Haufen von zerrissenen Mitgliedsbüchern bildeten. Ich hatte Gelegenheit, an einer Versammlung eines der Zweige des Bauarbeiter-Verbandes teilzunehmen, der beschlossen hat, in einer Anzahl von 800 Mann aus dem Verbande auszutreten und seine eigene Vereinigung zu gründen. Unter den Anwesenden waren ältere, teils parteilose Arbeiter, Meister ihres Handwerks, die keinerlei Not litten, die ihre Mitgliedsbeiträge seit Jahrzehnten regelmäßig zahlten.
In dieser Versammlung forderten alte Leute mit wuterstickter Stimme einen sofortigen und vollständigen Bruch mit den „Bonzen“. Kein Kommunist hätte die alte Partei mehr hassen, ihren Zusammenbruch stärker empfinden können. Vergeblich versuchten Mitglieder der KPD, die Versammelten von der Absicht abzubringen, einen „eigenen Laden“ aufzumachen, vergeblich versuchten sie sie zu bereden, die Gewerkschaften von innen heraus, durch die Bildung einer kräftigen, ihren Einfluss immer mehr verbreitenden Opposition zu revolutionieren, die schließlich imstande ist, die Bonzen zu stürzen und ihren Apparat an sich zu reißen, der wie eine Koralleninsel, Jahrzehnte lang gebaut wurde.
Die Partei und die hinter ihr stehenden Massen haben sich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich unendlich gefestigt. Ihre Aktivität ist nicht geschwächt, trotz der zahlreichen Verhaftungen (übrigens wurden die meisten nicht während des Aufstandes, sondern nachher, auf Grund von freiwilligen Denunziationen seitens der Arbeiter und Kleinbürger – der Mitglieder der SPD. – vorgenommen). Im Gegenteil: alle Mauern von Hamburg sind mit unauslöschlichen Aufschriften bedeckt. An jeder Straßenkreuzung, an jedem öffentlichen Gebäude liest man die Aufschrift: „Die Kommunistische Partei lebt. Sie kann nicht verboten werden.“
Mag der Reichstag für das „Ermächtigungsgesetz“ gestimmt haben; mag Seeckt die Fülle der Macht in seinen Händen haben, mag die weiße Diktatur die letzten Reste, die letzten kleinen Freiheiten der Arbeiter-Gesetzgebung vernichten – und doch sind alle Wände der Baracken, wo die Arbeitslosen registriert werden, von oben bis unten wie mit Tapeten mit den kleinen kommunistischen Plakaten beklebt. Wie Schneeflocken wirbeln sie in alle Versammlungen der SPD. hinein, kleben an den Wänden der Kneipen, an den Scheiben der Straßen- und Untergrundbahnen. Die Frauen der entfernten Viertel, deren ganze männliche Bevölkerung „unterwegs“, d. h. geflohen ist oder in Gefängnissen sitzt, fordern die Zusendung von Plakaten und Flugblättern, und wenn sie sich über etwas beklagen, so doch nur über das Fehlen einer billigen kommunistischen Zeitung. Alles das ist einer Niederlage so wenig ähnlich, daß die Richter der Kriegsgerichte, unter dem Druck der drohenden schweigsamen Massen, die Urteile zu mildern versuchen. Die Verurteilten gehen in die Festung oder in das Zuchthaus mit dem Stolz und der Ruhe von Siegern, mit der unerschütterlichen Gewißheit, daß die Revolution den Ablauf ihrer fünf, sieben oder zehn Strafjahre unbedingt unterbrechen wird, – sie gehen mit einem herablassenden Spott für die Gesetze des bürgerlichen Staates, die feige Brutalität seiner Polizei und die Festigkeit seiner Gefängnismauern. Dieser Glaube kann nicht täuschen.
Aber warum hat das ganze Land den Hamburger Aufstand nicht unterstützt?
Ganz Deutschland war in den Oktobertagen in zwei einander gegenüberstehende Lager gespalten, die auf das Angriffssignal warteten. Sachsen war schon mit der Polizei und der Reichswehr überfüllt. Somit hörte einer der wichtigsten Sammelplätze der Revolution auf zu existieren. Zahlreiche Gruppen von Arbeitslosen füllten noch die nächtlichen Straßen von Dresden, aber hinter ihnen, neben und vor ihnen stolzierten bewaffnete, herausfordende und freche Reichswehrtruppen.
Zu derselben Zeit forderte in Hamburg eine Konferenz von Arbeitern der ungeheuren Werften von Hamburg, Lübeck, Stettin, Bremen und Wilhemshaven eine sofortige Erklärung des Generalstreiks; es gelang ihren Leitern nur mit großer Mühe, einen Aufschub des Generalstreiks auf einige Tage zu erzwingen; die Arbeiter-Konferenz in Chemnitz lehnte infolge des sozialdemokratischen Einflusses den Generalstreik ab. Sachsen war schon erdrosselt, und das von den linken Sozialdemokraten im letzten Augenblick verratene Proletariat wich einem Zusammenstoß aus.
Berlin! Wer Berlin in den Oktobertagen gesehen hat, der erinnert sich gewiß an das merkwürdige Gefühl der Zwiespältigkeit, man möchte sagen – Doppelsinnigkeit, die den Grundzug seiner revolutionären Spannung bildete. Frauen und Arbeitslose prägten den Straßen den Stempel auf. Aufgeweckte Jungen trieben sich um die Polonäsen an den Bäcker- und Fleischerläden umher und pfiffen die Internationale. Der Sturz der Mark, die lächerlich geringen Unterstützungsgelder der Arbeitslosen, Kiregsinvaliden und Kriegerwitwen, die wucherische Ausbeutung der Arbeit, die unerschwinglichen Preise für alle Artikel des Alltagsgebrauchs, der Ruin der Kleinbourgoisie, das schamlose Verhalten der „großen Koalition“, der Aderlaß an der Ruhr, die Repressalien der Franzosen, die Kunststücke der deutschen Kapitalisten, die die Presse ans Tageslicht befördert hat – das waren die zweifellosen Anzeichen einer bevorstehenden Revolution. Die Autos der Reichen mieden schon die Vorstädte, die Polizei war schon so weit, daß sie gegen die Plünderung der Brotläden nicht mehr allzu scharf eingriff, draußen, vor der Stadt dröhnte schon die Artillerie, die man den streikenden Betrieben näherbrachte; der Lärm der Lastautos, voll beladen mit Polizei, mäßigte die Wut der Menge nicht, sondern hetzte sie noch mehr auf.
Und daneben – ungeheure, vollkommen passive Arbeitermassen, die noch immer zu der Sozialdemokratie zählen; breiteste Schichten des verbürgerlichten Proletariats, die sich hinter dem Rücken der Arbeitslosen und Kommunisten halten und sich gierig an ihr Stück Brot, an ihr gemütliches Heim, an ein Pfund Margarine klammern, – auch wenn sie für diese Margarine noch so viele Stunden arbeiten müssen. Eine feige, lärmende, gehässige Mehrheit, – bereit, bei sich zu Hause, bei einer Tasse schlechten Kaffees und mit dem „Vorwärts“ in der Hand ein paar Tage in aller Ruhe abzuwarten, – bis die Schießerei in den Straßen aufhört, bis man die Toten und Verwundeten fortgeschafft hat, bis ein Bolschewist, ein Ludendorff oder ein Seeckt – wer es auch sei – die Besiegten in die Gefängnisse gesteckt und die Regierung an sich gerissen hat. Bei einer außerordentlich aktiven Vorhut – eine zersetzte, verfaulte, abwartende Mehrheit, die jeden Augenblick bereit ist, – im Falle eines Mißerfolgs natürlich, – die kämpfenden Kommunisten zu verraten.
In Berlin wie in Hamburg (Ausnahmen bilden nur einige ausschließlich von Arbeitern bewohnte Stadtviertel), hätte das revolutionäre Proletariat der Polizei und den Truppen des Generals Seeckt – vollständig isoliert, ohne jede Hoffnung auf Unterstützung und vielleicht, ebenso wie in Hamburg, fast waffenlos – entgegentreten müssen.
Nichtsdestoweniger führte der in Hamburg unter den gleichen oder fast den gleichen Umständen unternommene Aufstand nicht nur zu keiner Niederlage, – seine Ergebnisse waren im Gegenteil geradezu verblüffend. Es ist wahr, hinter seinem Rücken stand das ganze Arbeiter-Deutschland, das von der Gegenrevolution im offenen Kampfe nicht geschlagen war und daher den heroischen Rückzug seines Hamburger Schrittmachers materiell und moralisch decken konnte.
Jedenfalls besteht die Arbeit einer sieghaften Partei nicht allein im fieberhaften Auflauern der „zwölften Stunde der Bourgeoisie“, des historischen Augenblicks, wenn der Zeiger der Zeit nach einem kurzen Augenblick des Schwankens die ersten Sekunden der Kommunistischen Aera mechanisch auslöst.
Es gibt ein altes deutsches Märchen von einem tapferen Ritter, der sein ganzes Leben in einer verzauberten Höhle in der Erwartung zugebracht hat, daß der langsam anschwellende, am Tropfstein sich bildende Wassertropfen ihm endlich in den Mund fällt. Und immer hinderte ihn im letzten Augenblick irgendeine Bagatelle, irgend ein dummer Zwischenfall daran, den so sehnsüchtig erwarteten Tropfen aufzufangen, der dann zwecklos in den Sand fiel. Das Furchtbarste ist natürlich nicht der Augenblick des Mißerfolgs selbst, sondern die tote, leere Pause der enttäuschten Erwartung zwischen der einen Flut und der nächsten.
In Hamburg verfuhr man nicht wie der Ritter und wartete nicht mit offenem Munde auf das Himmelsnaß. Das, was man hierzulande so wundervoll und kurz Aktion zu nennen pflegt, ist in eine starke Kette des fortwährenden Kampfes eingeschmiedet, mit den vorhergehenden Gliedern verbunden und auf die Zukunft gestützt, deren jeder Tag – ob des Sieges oder der Niederlage – unter einem Zeichen steht, das die Welt, wie die Faust eines Dampfhammers, bricht.
Und außerdem ereignete sich der Aufstand nicht in der Provinz Brandenburg, nicht in Preußen, nicht im Berlin des Parlaments, der Siegesallee und des Generals v. Seeckt, sondern an der Wasserkante.
HAMBURG
II.
Wie ein großer, eben gefangener, noch zuckender Fisch liegt Hamburg an der Nordsee.
Ewige Nebel lagern auf den zugespitzten schuppigen Dächern seiner Häuser. Kein Tag hält seinem blassen, windigen, launischen Morgen die Treue. Mit Flut und Ebbe wechseln dumpf nasse Wärme, Sonne, graue Kälte des offenen Meeres und lärmender Regen, der auf den blanken Asphalt niederströmt, als wenn jemand, am Seeufer stehend, mit einem alten durchlöcherten Schiffseimer die halbe Elbe auf das wie ein Lotsenmantel wasserdichte, von Feuchtigkeit rauchende, wie eine Matrosenpfeife stinkende, von dem Grog der Hafenkneipe erwärmte, lustige Hamburg ausschüttete, – auf das Hamburg, das mit breitgespreizten Beinen auf den beiden Ufern der Elbe fest dasteht.
Wie ein Vorurteil, wie etwas, das nicht mehr in unsere Zeit gehört, ist die Natur allenthalben an den Ufern dieses Industrieflusses ausgemerzt. Kilometerlang sieht man keine Bäume, und wenn man einen erblickt, dann sieht er wie ein Mast aus, der von einem Schiffbruch übrig geblieben ist; ich habe zwei Bäume gesehen – den einen an der Mole – verkrampft und gebückt wie eine Alte, die gegen den Wind kämpft, der ihre wollenen Strümpfe mit zornigen Schaumflocken bewirft. Den zweiten – am Kontor der größten der Hamburger Werften, der Werft von Blom & Voss.
Dieser Baum steht nur aus Angst da: unter ihm – ein widerwärtiger schwarzer Kanal, in den sich die Fabriken durch die aufgesperrten Rachen der Zuflußrohre erbrechen. Eine Brücke, das Häuschen eines Postens, und am anderen Ufer, im blassen Licht der fünften Morgenstunde, – die glänzenden Fenster der unsichtbaren Gebäudekomplexe; endlose Reihen übereinander, knüpfen sie ihr elektrisches Licht an das Tageslicht an.
Der Wunder größtes Wunder, das Schlankste, was das Reich des schlanken Metalls kennt, – sind die sich über den Hafen beugenden leichten Tore der größten Hebekrane, die es in der Welt gibt. Zu ihren Füßen liegen wie aufgetürmtes Spielzeug fertig gebaute Ozeandampfer, mit erleuchteten Bordfenstern , – als wenn sie wie Schwäne aus dem Wasser gehoben wären.
Hier arbeiten drei Schichten – krampfhaft, unbarmherzig.
Hier macht die deutsche Bourgeoisie, indem sie Arbeiter wie nasse Wäsche auswindet, die letzten hoffungslosen Versuche, die sie paralysierende Krisis zu überwinden: sie baut, schafft neue Werte, bevölkert den Ozean mit ihren weißen schwarzröhrigen Schiffen, an deren Heck das alte kaiserliche schwarz-weiß-rote Banner mit einem kaum merklichen republikanischen Fleck weht.
Alles, was sonst Himmel heißt, ist hier in Hamburg – der Rauch der Fabrikschlote, die Greifarme der Hebekrane, die die Schiffsbäuche plündern und steinerne Riesenkästen auffüllen; leichte, flüchtig geneigte Brücken überdecken die nasse Geburtsstätte der neu entstandenen Schiffe. Heulen der Sirenen, Fluchen der Pfeifen, Flut und Ebbe des Ozeans, der mit dem Unrat spielt und mit den Möven, die wie Schwimmhölzer auf dem Wasser tanzen, und – gleichmäßige Würfel dunkelroter, aus Ziegel gebauter Gebäudekomplexe, Lager, Fabriken, Kontore, Märkte und geradlinig gebauter Zollämter.
Eine Armee, Legionen von Arbeitern sind in diesen Werften bei dem Laden und Löschen der Schiffe in den zahllosen Metallwerken, chemischen Fabriken, in einigen der größten Manufakturen und auf den großen Bauplätzen beschäftigt, die das Hinterland von Hamburg, seinen sumpfigen und sandigen Grund ununterbrochen mit einer Kruste von Beton und Stahl bedecken.
Die Elbe, dieses alte schmutzige Einkehrhaus für die Strolche des Ozeans – baut und erweitert ununterbrochen ihre Hinterhöfe.
Hier werfen die Seerosse ihre Last ab, hier fressen sie Naphta und Kohle, hier reinigen und waschen sie sich – während die Kapitäne dem Zollamt die Schmiergelder zahlen, die Papiere richtig zugestutzt werden und die Barbiere ihr Verschönerungswerk an den Gesichtern der Schiffsgewaltigen vornehmen, die dann zu ihren Familien an Land gehen, indes die Mannschaft im Stadtviertel der Kneipen, der Kleiderbuden, der Versatzämter, wo der eben gekaufte Anzug sofort versetzt werden kann, und endlich der erstaunlichsten Bordelle – in St. Pauli untertaucht. Des Abends öffnet sich in jeder auf die Gasse hinausgehenden Tür ein kleines erleuchtetes Fenster, aus dem die Königinnen dieser Matrosen-Paradiese lächelnd in die ewige regnerische Dunkelheit hinausblicken. Sie stecken in tief ausgeschnittenen, an der Taille eng zusammengerafften, mit Flitterwerk und Federn benähten Kleidern, mit denen die Mode aus dem Ende des letzten Jahrhunderts, die nur noch in den Anpreisungen der billigen Parfümerieartikel und in der Vorstellung der nach dem Weibe ausgehungerten Matrosen fortlebt, – die Verkörperung der höchsten Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen pflegte.
In diesen Handelsreihen wird lebendiges Fleisch mit ungekünstelter schlichter Einfalt verkauft. Die Besucher gehen von einem Schaufensterchen zum nächsten, besehen sich die ausgestellte Ware und treten ein, um nach einer Weile, von schweren Flüchen und lautem Lärm begleitet, auf das Straßenpflaster hinauszufliegen: St. Paulis Torhüter sind ihrer körperlichen Kräfte wegen weit und breit berühmt.
In den kleinen Kneipen dieser Vorstadt klingen alle Sprachen und vermischen sich alle Nationen. Witz, Eiergrog, völlige Unantastbarkeit von Seiten der Polizei, ein erstaunliches Gemisch von Mut, Alkohol, revolutionärer Entflammbarkeit, Tabakrauch herrschen hier und – vor allem – die letzte, verwelkte, hoffnungslos gefallene Sünde, die an einem mit saurem Bier begossenen Tisch einem betrunkenen namenslosen Adam für ein Butterbrot die göttlichste der Lügen – die Liebe vortäuscht.
Die Sprache, die hier gesprochen wird, ist die Sprache Hamburgs.
Sie ist durch und durch mit der See gesättigt und salzig wie ein Klippfisch. Rund und saftig wie ein holländischer Käse, derb, gewichtig und munter, wie englischer Schnaps; glatt, reich und leicht wie die Schuppen eines Tiefseefisches, der unter Karpfen und fetten Aalen im Korbe einer Marktfrau, in allen Farben schillernd, langsam erstickt. Und nur der Buchstabe „S“, spitz wie eine Nadel, anmutig wie ein Schiffsmast, zeugt von der alten Gotik Hamburgs, von den Zeiten der Begründung der Hansastädte.
Nicht nur das Lumpenproletariat allein – die ganze Stadt ist durchsetzt von dem lebendigen, beweglichen Geiste des Hafens. Von allen Seiten umschließt sein dichter Ring die bürgerlichen, um die Alster gelegenen Viertel, diesen Binnensee, der von der altlantischen Flut und Ebbe durchpulst wird. Die Villen sind dicht ans Ufer gedrängt, sie haben kaum den nötigen Raum, um ihre schmucken Gärten, die mit ihren Blumen, Tennisplätzen, Treppenfluten geschmückt sind, zu entfalten.
Die Häuser der Patrizier spüren in ihrem Nacken den unsauberen, erregten Atem der Vorstädte. Der Ring der elektrischen Bahn spannt die gedrängten Vorstädte um die eleganten Viertel; zwei Mal am Tage saust der trübe Strom der Arbeiter, die Stadt nach den Docks zu durchquerend, die Wagen mit dem Geruch von Schweiß, Teer und Alkohol erfüllend, um ihre Villen.
Auf diese Weise gehorcht ganz Hamburg ebensosehr der Mittagspfeife der Werften, dem morgendlichen und abendlichen Namensausruf an den Ufern der Elbe, wie die kleinste Pfütze, ein armseliger Froschteich, dem fernen Pulsschlag des Ozeans gehorcht, der Hamburg seine Reichtümer und seine unermüdlichen Winde schickt.
Der Bourgeois, der ehrbare Bürger, ist ebensowenig wie seine Wohnung, gegen die Berührung und die Nachbarschaft der Proletarier gesichert. Die Dame, die abends ins Theater fährt, sitzt zwischen zwei Dockarbeitern eingezwängt, die ihre öligen Säcke in aller Gelassenheit auf die weichen Sitzbänke niederlassen.
Eine Dirne aus St. Pauli sitzt neben der Gattin eines Beamten, zwinkert den Nachbarn zu und steigt an der nächsten Haltestelle aus – schon am Arm irgendeines von ihnen; der Arbeiter umarmt seine Frau oder seine Freundin; der Löscharbeiter umwölkt seinen nächsten mit seinem unausdenkbaren Tabak; Freunde schleppen einen betrunkenen Matrosen nach Hause, und der ganze Wagen amüsiert sich mit ihnen, denkt, spricht und lacht im reinsten Hamburger Platt, das geeignet ist, jeden beliebigen Ort sofort in eine lustige Hafenkneipe zu verwandeln.
Von unserm Gesichtspunkte aus betrachtet, ist das alles nicht sehr wichtig. Aber nach Berlin, wo der Arbeiter mit seinen Instrumenten nur in einem besonders schmutzigen und unsauberen Wagen fahren darf, wo das Vorrecht der 2. Klasse, nahezu unter polizeilichem Aufgebot verteidigt wird; wo der Arbeitslose, sich seine vor Kälte violetten Ohren reibend, es kaum wagen darf, sich auf einer der zahllosen, stets leeren Bänke des Tiergartens auszuruhen; nach dem offiziellen bürgerlichen Berlin riecht allein schon die Luft von Hamburg mit seiner Einfachheit und seinen freien Sitten nach Revolution.
Um vier oder fünf Uhr nachts schläft das Lumpenproletariat der Stadt an irgend einem beliebigen Platz oder wird ins Polizeirevier geschafft.
Ein Viertel vor sechs, noch bei elektrischem Licht, setzt die erste Arbeiterflut ein.
Ueber der Straßenbahn hängt in der Dunkelheit die Stadtbahn, kurze, leuchtende Bänder der elektrischen Züge der Hochbahn winden sich über dieser, und alle zusammen schaffen eine ganze Armee, hunderttausende von Arbeitern und weitere hunderttausende von Arbeitslosen, die, in der Hoffnung auf einen gelegentlichen Verdienst, die Anlegestellen umlagern, zum Hafen. Jeder Trupp sammelt sich um seinen Meister, zwischen den geteerten Jacken, höckrigen, mit Werkzeug beladenen Schultern, leuchtet ein Oellämpchen. Nach dem Aufruf verteilen sich die Arbeiterregimenter auf hunderte von Dampfern, die sie in die Werften und Betriebe bringen. Durch vier Brücken strömen sie in das Industriezentrum. Truppen und Polizei passen scharf auf, daß kein einziger „Zivilist“ auf die Industrieinseln dringt. Aber auch diese Brücken und hunderte von Dampfern, die mit ihren Lichtern und Scheinwerfern, einen unerhörten Karneval, ein schwarzes, geteertes Venedig aufführen, – genügen der Flut der Morgenschicht nicht. Tief unter dem Elbgewässer liegt ein trockenes, helles Rohr, der Elbtunnel, das morgens und abends Legionen von Arbeitern von Ufer zu Ufer pumpt.
An beiden Enden dieses Tunnels heben und senken sich Riesenlifts und werfen den Strom zu den Betonausgängen.
In ihren eisenknarrenden, schraubenförmigen Türmen bewegen sich diese beiden Lifts wie zwei mächtige Schaufeln, die unausgesetzt lebendiges Heizmaterial in die zahllosen Feuerungen der Arbeit schleudern. Und aus der Esse dieser Fabriken kam der Hamburger Aufstand.
BARMBECK
III.
Die Hamburger Arbeiter leben weit ab von ihren Fabriken und Werften, unter anderem in einem Stadtteil, genannt Barmbeck. Es ist eine ungeheure Kaserne, deren Häuser einander gleichen, wie Schlafzimmer von Mietskasernen, verbunden von unsauberen, nackten Korridoren der Straße. Sie stoßen an öde Plätze, die eher öffentlichen Küchen oder Bedürfnisanstalten gleichen – mit ihren öden, stillstehenden Springbrunnen und bleiernem Himmel darüber. Durch diese reichlich schmutzige und widerwärtige Vorstadt zieht einen stählernen Halbkreis die riesenhafte Raupe einer Eisenbahnbrücke. Ihre leicht gebogenen Füße halten sich mit Saugwarzen aus Beton am Asphalt fest. Der Kopf dieses Riesenwurms verschwindet, von zwei Häusern zusammengepresst, in den Spalten der Hinterhöfe, Brandmauern und Schluchten, erfüllt von Trauben winziger Balkons, auf denen Wäsche trocknet und rauchgesättigter Efeu flattert. Auf dem Schwanz der Raupe sitzt ein Bahnhofsgebäude, durch dessen offenen Spalt die Fahrgäste herausströmen.
Gerade dem Bahnhof gegenüber liegt ein Polizeirevier, ein Gebäude mit trüben, an die dunklen Brillengläser eines Spitzels erinnernden Fenstern, umgeben von Stacheldraht, an dem Fetzen alter Aufrufe wehen. Ein Posten davor – das ewige Einerlei des Reviers, die bedrückende Langeweile und der Haß des Kanzleilebens, zerkaut wie ein vom Boden aufgehobener, bereits zweimal angezündeter Zigarettenstummel.
Der Hafen ist nur zu bestimmten Zeiten für die Arbeiter geöffnet. Im Grau des Morgens saugt er die Armee der Arbeitenden in sich auf und speit sie des Abends bis auf den letzten Mann aus. In der sich leerenden Industriefestung bleiben nur Truppen, die Brücken und Tunnels bewachen, durch die der verdichtete Strom der Arbeiter die Anlegestellen erreicht. Kein einziger Arbeiter lebt im Hafen selbst. Dies Privileg genießen nur erprobte alte Diener der industriellen Grandseigneurs; die wenigen bittend-flimmernden Flämmchen ihrer Wohnungen ducken sich ängstlich im ungeheuren Schatten der erloschenen Gebäude, die in Nacht und Nebel ausatmen, was sie den Tag über eingesogen haben: menschliche Wärme. Posten schreiten an den menschenleeren Kais entlang; Bajonette verwehren jedem den Zutritt, Laternen werden dicht vor das Gesicht gehalten.
„Wer, wohin, wozu, die Parole?“
In Barmbeck begannen die Unruhen eine Woche vor dem Aufstand. Mittwoch, den 16. Oktober, nehmen Arbeiterinnen und Frauen der kleinen Angestellten die Märkte in Besitz und zwingen die sabotierenden Händler, ihre Waren zu verkaufen.
Donnerstag und Freitag bilden sie eine Kette vor den Werften und veranlassen so die beschämten Männer, nach Hause zurückzukehren. Am selben Tage demonstrieren 15 000 Arbeitslose und Frauen auf dem „Heiligengeistfelde“. Sonnabend findet im Gewerkschaftshause eine ungeheure Versammlung statt, von wo die tausendköpfige Menge zum Rathaus zieht und die bewachte Bannmeile durchbricht.
Des Abends schreiten Zehntausende von Arbeitern unablässig, hartnäckig über die Fußstege, – die Polizei verhaftet über hundert Menschen, aber die unheimlichen Fußgänger sind nicht zu vertreiben. Aufregende Nachrichten verbreiten sich mit fieberhafter Eile: die Reichswehr greift die Arbeiter in Sachsen an. Die Massen geraten in furchtbare Spannung. Es ist der Vortag der Revolution.
Am Sonntag, den 21. Oktober, versammelt sich eine Konferenz von Werftarbeitern der Nord- und Ostsee-Küste – Bremen, Kiel, Rostock, Stettin, Swinemünde, Lübeck und Hamburg. Eine Reihe der Delegierten gehörte der VSPD. an, viele von ihnen sind von Betrieben geschickt worden, die schon einige Tage streiken. Dem Metallarbeiter-Verband, der diese Streiks als „wilde“ bezeichnet hatte, haben sie schon ihre Mitgliedsbücher zurückgeschickt. Ein harter Zusammenstoß zwischen einem alten SPD.-Mann, einem Delegierten von Stettin, der in den 28 Jahren seiner Gewerkschaftsbeamtenlaufbahn schon längst von Moos und Schlamm überwuchert ist, – und X., einem quadratischen, knotigen, seine schwere Faust wie eine Keule schwingenden Arbeiter, der die Zügel des Hamburger Aufstandes fest in seiner eisernen Hand hielt.
Hier in dieser Konferenz mußte er gleichzeitig antreiben und zurückhalten. Ein alter Kutscher, gewohnt, mit seinen schwer beladenen Wagen steile, vereiste Brücken zu erklimmen, – trieb er in dieser Konferenz an und bremste gleichzeitig, sich nur mit großer Mühe auf dem Bock haltend; sein helles Peitschenknallen vertrieb die Gewerkschaftsbeamten, die mit der ganzen Schwere ihrer Autorität am schaumbedeckten Zügel der sich aufbäumenden, nicht mehr erwägenden, in ihrer Wut blinden Bewegung hingen.
Nur mit Mühe und Not gelingt es, die stürmische Versammlung von Funktionären zu überzeugen und zur zur Ruhe zu bringen und dazu zu bewegen, den Generalstreik auf einige Tage hinauszuschieben.
Sonntag Nacht bringt ein Kurier die (fälschliche) Nachricht von einem Ausbruch in Sachsen. Der Befehl des Generalstreiks wird sofort den Rayons mitgeteilt. Dutzende der größten Betriebe schließen sich der Deutschen Werft an, die schon seit Sonnabend abgesperrt ist.
Die zweite Arbeiterschicht verlässt die Werkstätten, durchbricht die Polizeiketten und dringt in das Zentrum ein. Gegen vier Uhr ist der Hafen stillgelegt. Eine hunderttausendköpfige Menge wogt durch die Straßen Hamburgs, verleiht ihnen das Aussehen einer bereits vom Aufstand erfaßten Stadt.
In später Nacht Sitzung des „Kopfes“; die Leiter der Kampforganisation erhalten Befehle, die sie mit dem Gefühl der größten inneren Befriedigung empfangen. X., der einige Stunden lang für einen Aufschub kämpfte, der mit seiner Person alle Lücken verstopfte, durch die die Bewegung vorzeitig durchzubrechen drohte, – lässt die Zügel los, hebt alle Dämme, öffnet alle Hähne, die den brodelnden Strom des Aufstandes noch zurückhalten.
Um Mitternacht gehen die Führer auseinander, um die Mitglieder der Arbeiterhundertschaften zu benachrichtigen und zusammenzubringen. Die Partei in ihrer Gesamtheit und die breiten Massen der parteilosen Arbeiter sollten erst am Morgen von dem Aufstand erfahren, nachdem alle Polizeireviere von den Stoßtrupps der Kampforganisationen besetzt wären. Der Sturm auf die Polizeibüros wurde am 23. Oktober gleichzeitig in allen Stadtteilen geplant und erst nachdem diese eingenommen waren – die Einnahme und Entwaffnung der Wandsbeker Kaserne. Die militärischen Leiter sollten bis zu diesem Augenblick die Nacht über mit ihren Leuten zusammenbleiben, niemand nach Hause entlassen und kein Licht entzünden; unter keinen Umständen durften die Leute „zur Verabschiedung der Familie“ beurlaubt werden. Nur diesen Vorsichtsmaßregeln ist es zu verdanken, daß die Polizei überrascht und ohne weiteres entwaffnet werden konnte. Man muss F. und jenen anderen Genossen Gerechtigkeit widerfahren lassen, die mit ihm zusammen diesen Kampfplan ausgearbeitet haben. Sie hatten die Sache halb gewonnen, als sie dem Aufstand diesen stillen, unvorhergesehenen Stoß der Kampforganisation voranschickten, der – 1. den Gegner seiner Stützpunkte – der Polizeireviere – beraubte, 2. die Arbeiter auf Kosten der Polizei bewaffnete, 3. in den Massen ein Bewusstsein eines schon erfochtenen Sieges erzeugt und damit sie in den kaum begonnenen Kampf um so leichter hineingezogen hat. Die Regierung hat die Dislokation des Aufstandes richtig eingeschätzt. Folgendes schreibt darüber der Hamburger Polizeisenator Hense (ein Sozialdemokrat):
„Das Schlimmste an diesem Aufstand ist keineswegs die zahlenmäßige Schwäche der uns zu Verfügung stehenden Truppen. Nein, schrecklich ist, daß die Kommunisten es diesmal, im Gegensatz zu allen früheren Putschen, verstanden haben, ihre langen und ernsthaften Vorbereitungen so geheim durchzuführen, daß kein einziger Ton zu unserer Kenntnis gelangt war. Gewöhnlich waren wir bis in die letzten Einzelheiten von allem unterrichtet, was im Lager der Kommunisten vor sich ging. Nicht, daß man besondere Spitzel in ihren Reihen hätte unterhalten müssen, nein, das ordnungsliebende Publikum, zu dem ich auch die Arbeiter, die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei zähle, hat uns gewöhnlich ohne jedes Dazutun unsererseits von allem unterrichtet, was im Lager der Kommunisten vorging.“
Dieses Mal war es den „ordnungsliebenden Menschewisten“ nicht gelungen, die Regierungsgewalt zu warnen. Sie wußten selbst nichts, sie wußten so wenig, daß der Belagerungszustand, der während der letzten Woche die Polizei in einem Zustande der steten erhöhten Bereitschaft hielt, von der Regierung ausgerechnet in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgehoben wurde – also gerade am Vortage des Aufstandes.
Aber kehren wir in unserer Schilderung zu einem Zeitpunkt einige Stunden vor dem Aufstand zurück. Hier einige Kleinigkeiten, die die Stimmung der Partei im Augenblick ihrer Mobilmachung schildern, als man die Menschen plötzlich überraschte, sie aus ihren Betten zerrte und fortführte – sie wußten nicht wohin. Es ist Morgendämmerung, man ist noch halb im Schlaf, empfindet die Kälte unerträglich, man möchte weiterschlafen – alles ist in eine freudlose graue Farbe getaucht, kurz, es ist ein Augenblick, in dem die heroischen Posen nicht gerade an der Tagesordnung sind. Alles, was gesagt wird, klingt wahr und grob.
Einer der Führer des Aufstandes schreitet seine Bezirksleiter ab, um ihnen den Befehl des bevorstehenden Aufstandes zu überbringen.
Eine menschenleere Straße, ein schlafendes Haus, eine schwüle, schnarchende Wohnung. Ein Heim des ärmsten Arbeiters. Er steht auf, zieht sich an, ohne zu fragen wozu und wohin, ohne einen Augenblick zu zögern. Ein ruhiger Händedruck, – und die glimmende Zigarette entfernt sich langsam in der Dunkelheit.
Ein anderer Winkel – in einem Arbeiterviertel. Die Frau öffnet die Tür, hilft dem Mann die Sachen zusammenzubringen, leuchtet mit einem Lichtstummel über den Küchentisch, auf dem der Stadtplan ausgebreitet liegt. Sie nimmt sich lange zusammen und tief klingt es, mit einem Gefühl der größten Befreiung, als sie sagt:
„Endlich geht’s los …“
In der dritten Behausung sagt die Frau zu ihrem Mann, der nicht schnell genug fertig wird:
„Nu mock di man fertig!“1
Endlich, die St.-Georgs-Vorstadt. Hier wird nicht geschlafen. Im Hinterzimmer brennt eine Lampe, sie zuckt im Tabaksqualm. Die Hausfrau antwortet ausweichend – er sei zu Hause und auch wieder nicht, sie wisse von nichts. Auf der Treppe behutsame Schritte, die Tür öffnet sich plötzlich – Gen. R. erscheint, mit einem rußig geschwärztem Gesicht, barfuß, mit einem Pack Gewehre unter dem Arm; seine Taschen sind mit allerhand Munition vollgestopft. Eine freudig lächelnde Physiognomie von jenem Typus, der in Hafenkneipen am besten unter dem Namen Rowdy bekannt ist. Was gibt’s? Sie haben ein ganzes Waffenmagazin zusammengebracht. Dieser Genosse ist natürlich kein richtiger Genosse, sondern nur ein sympathisierender. Aber die Gewandheit, mit der er das Schloß des Gewehrs handhabt, ist verblüffend … Rowdy verbeugt sich mit der schlichten Einfachheit eines Künstlers.
Der Genosse bekommt die Parole und den Plan der Besetzung des nächsten Polizeireviers mit den in ihm befindlichen Waffen; er sagt im Ton des tiefsten Bedauerns:
„Mensch, den har ick dat jo nicht mehr neudig hat!“2
Der ganze Barmbecker Kampf, der drei Tage lang währte, wurde in seiner ersten Phase um das Rückgrat der Eisenbahn dieser Vorstadt geführt, das die Arbeiter nicht zu brechen vermochten, – teils aus Mangel an Waffen, in der Hauptsache aber – aus Mangel an Explosivstoffen. Ihre Lage wurde besonders dadurch erschwert, weil eines der schwierigsten, im Rücken der Aufständischen liegenden, Stadtviertel (die Von-Essen-Straße) von ihnen nicht eingenommen war und daher fortwährend bedeutende Kräfte in Anspruch nahm. Dieses Polizeirevier entging ihnen ganz zufällig. Während H., ein mächtiger Arbeiter, der sich durch eine besondere undurchdringliche, wie frischer Asphalt durchgewalzte Ruhe auszeichnete, mit zwei Genossen durch den Haupteingang des Reviers einbrach und mit nicht mißzuverstehendem Nachdruck sofortige Uebergabe forderte – und die Blauen und Grünen schon ihre Gürtel abzuschnallen anfingen, begann eine andere Abteilung der Aufständischen, die das Gebäude durch den Hinterhof erreichte von der völligen Ruhe im Innern verblüfft gegen die Fenster des Reviers zu feuern. Die Sipo und die Reichswehr kam auf einmal zu sich, erblickte drei unbewaffnete Arbeiter vor sich und – schoß zwei nieder, Einer wurde verletzt. Die Sipo schließt sich darauf im Keller ein und bewirft die angreifenden Arbeiter mit Handgranaten. Die Aufständischen ziehen sich zurück. An der ersten Wegkreuzung werden sie von einem Genossen aufgehalten, der in Erwartung der angreifenden Truppen sein festes Netz von Barrikaden errichtete.
Ein einziger Offizier für den ganzen Hamburger Aufstand, – aber wieviel hat er für ihn getan! – Es gab keine Straßen in Barmbeck, keine Gasse, keinen einzigen Durchschlupf, den er nicht mit zwei, drei Hindernissen versperrt hätte. Die Barrikaden wuchsen wie aus der Erde, vermehrten sich mit unglaublicher Schnelligkeit. Es gab keine Sägen und keine Schaufeln, – man verschaffte sich welche. Die Bewohner wurden zu Erdarbeiten herangezogen, – schwitzend schleppten sie Steine herbei, wühlten das Pflaster auf und sägten die geheiligten Bäume der öffentlichen Gärten nieder; sie waren bereit, sich selbst in die Luft zu sprengen – nur im ihre Schränke und Kommoden, Betten und Küchen vor dieser wilden Bautätigkeit zu bewahren.
Nur eine alte Frau machte eine Ausnahme – sie berührte den Führer am Aermel, und veranlaßte ihn, ihr zu folgen – um ihm ein starkes, breites Brett von ihrem Waschtisch – den Stolz der Wirtschaft – mitzugeben. Das Brett fand seine Verwendung und hielt sich standhaft bis zum Ende. Aber das war nur eine Ausnahme.
Im allgemeinen hat sich die alte romantische Barrikade schon längst überlebt. Das Mädchen mit der Phrygischen Mütze schwenkt nicht mehr das durchlöcherte Banner über der Barrikade, es gibt keine Versailler mehr, die in weißen Gamaschen den mutigen Gamin erschießen, es gibt nicht mehr den Studenten aus dem Quartier Latin, der ein Spitzentaschentuch auf seine Todeswunde drückt, während ein Arbeiter seine letzte Kugel aus dem langen altmodischen Lauf der Pistole abschießt. Die Kriegstechnik hat dieses ganze liebe romantische Gerümpel in die Geschichtsbücher verwiesen, wo es noch immer fortlebt, umrankt von Legenden und dem Pulverrauch des Jahres 48. Jetzt kämpft man anders. Die Barrikade, als eine Festungsmauer zwischen den Gewehren der Revolutionäre und den Geschützen der Regierung, ist längst verschwunden. Sie dient keinem mehr als Schutz, sondern allen als Hindernis. Jetzt ist es eine leichte aus Bäumen, Steinen, umgestürzten Wagen gebildete Wand, die einen tiefen Graben vor den Panzerautos, vor diesen gefährlichsten Feinden des Aufstandes schützt. Gerade im Schützengraben liegt der Zweck des Bestehens der zeitgemäßen Barrikade. Aber die alte Barrikade fährt doch immerhin fort – wenn auch in einer anderen Form, als ihre heroische Großmutter der Jahre 23 und 48 – den Insurgenten in aller Treue zu dienen.
Quer über die Straße getürmt, macht sie es unmöglich zu erkennen, was eigentlich hinter ihren drohenden zerzausten Kulissen geschieht, – sie lenkt die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich, dient ihm als die einzige sichtbare Zielscheibe. Die Barrikade empfängt mit ihrer leeren Brust das ganze wilde Feuer, das die Truppen gegen den unsichtbaren Gegner abgeben.
Und noch ein neuer Zug, der das Bild des Bürgerkrieges, seine ganze Strategie und Taktik vollständig verändert hat. Die Arbeiter sind unsichtbar, unfaßbar geworden. Die neue Kampfmethode erfand für sie eine Art Tarnkappe, die sich jedem Schnellfeuer zu entziehen vermag. Die Arbeiter kämpfen fast nicht mehr in den Straßen, die sie vollständig der Polizei und den Truppen überlassen. Ihre neue Barrikade – mit Millionen von zuverlässigen Schlupfwinkeln – ist die Arbeiterstadt in ihrer Gesamtheit, mit allen ihren Kellern, Böden und Wohnungen. Jedes Fenster des ersten Stockwerks ist eine Schießscharte dieser uneinnehmbaren Festung. Jeder Dachboden ist eine Batterie und Beobachtungsposten. Jedes Bett eines Arbeiters ist ein Krankenlager, auf das der Aufständische im Falle seiner Verwundung rechnen kann. Nur dadurch erklären sich die ungeheuerlichen Verluste der Regierung, während die Arbeiter in Barmbeck nur etwa ein Dutzend Verwundete und einige Tote hatten.
Die Truppen sind gezwungen, auf offenen Straße anzugreifen. Die Arbeiter nehmen den Kampf bei sich zu Hause auf. Alle Versuche der regulären Truppen, Barmbeck am Dienstag einzunehmen, scheiterten gerade an der verstreuten, unsichtbaren und unfaßbaren Aufstellung der Schützen, die von irgendwo, aus den Fenstern des zweiten Stockwerks, sich in aller Ruhe das Ziel suchten, während unten die hilflosen Haufen der Polizei die leeren Barrikaden buchstäblich mit Feuer überschütteten. In der Voraussicht einer Attacke seitens der Panzerautos gelang es ohne Dynamit und Pulver eine Betonbrücke zu sprengen, die als ewig galt. Die Arbeiter fanden ihre verwundbare Arterie – ein starkes Gasrohr – heraus, deckten es auf und setzten es in Brand.
Eines der Panzerautos stürzte blind in eine stille menschenleere Straße hinein. Es macht halt, um etwas an seinem Mechanismus zu reparieren. Im nächsten Augenblick wächst eine Barrikade vor ihm auf. Das Auto macht kehrt – abgesägte Bäume kreuzen schon hinter dem Wagen ihre Wipfel auf dem Straßenpflaster.
Der Panzerwagen Nr. 14 bewegt sich vorsichtig unter einer Eisenbahnbrücke. Ein Chauffeur und fünf Mann Sipo sitzen in ihm. Hinter einer Kneipe, hinter der Ecke, man weiß nicht woher, aber aus nächster Nähe fällt ein Schuß und dann noch einer. Der Chauffeur ist tot, auch einer der Sipoleute. Burschen aus dem Jugendbund schlagen den Panzerwagen kurz und klein.
Die eigentlichen Kämpfe dauern den ganzen Dienstag an. Die ersten Attacken beginnen gegen 11 Uhr vormittags. Am hartnäckigsten spielen sie sich an der Von-Essen-Straße ab und längs der Barrikadenlinie, die sich von beiden Seiten dem Eisenbahndamm zuwendet. Die Polizei stürmt den Bahnhof. Ihre Abteilungen laufen den Bahndamm entlang, um die Kämpfer von oben zu vertreiben. Der erste und der zweite Hinterhalt lassen sie ungeschoren vorbeilaufen. Vom dritten überschüttet sie ein mörderisches Feuer. Man schießt nicht nur hinter den Deckungen hervor, sondern auch von allen umliegenden Dachböden. Die Schützen sind auf den Dächern verstreut, halten ganze Straßen, die wichtigsten Kreuzungen und Plätze unter Feuer.
Unten ist ein Schützengraben und eine Barrikade. Sie hält sich schon einige Stunden. Eine Abteilung Sipo greift immer erbitterter an. Da ertönt ein Schrei von oben:
„Die Barrikade frei!“
Die Leute wissen nicht, was los ist. Ein noch junger Arbeiter von etwa 23 Jahren, offenbar verwundet, – seine Schulter ist blutig, der Hals und die Hüfte ebenfalls, – steigt zu ihnen hinab. Er befiehlt die Barrikade zu räumen, da die auf dem Dach liegenden Aufständischen bei der Beschießung der Sipo ihre eigenen Leute zu gefährden fürchten. Der Arbeiter verschwindet wieder im Hauseingang, und einige Minuten darauf zwingt das Feuer von den Dächern die Polizei, sich zurückzuziehen.
Noch eine Barrikade, die stundenlang den hartnäckigsten Widerstand leistete. Von oben, von den Dachböden steigen viele einzelne Schützen hinab. Von ihrem Beobachtungsposten aus haben sie schon von weitem das Nahen eines Panzerwagens bemerkt und beschlossen, daß es besser sei, den Wagen von unten anzugreifen. Einem von ihnen gelang es, mit einem glücklichen Schuß den Kühler zu treffen: die Maschine ist defekt. Die Schützen kehren wieder in ihren Taubenschlag zurück.
Indessen werden die Kämpfe am Bahnhof immer heißer. Den Arbeitern gelingt es nicht nur, einige feindliche Kolonnen von dem Bahndamm zu vertreiben, – sie versuchen auch selbst zum Angriff überzugehen. Aber der freie Platz vor dem Viadukt wird von Panzerwagen beschossen. Es ist unmöglich, ihn zu passieren. Da beginnt ein Wald von mächtigen Baumstämmen aus dem nächsten Holzlager sich in Bewegung zu setzen, ungeheure Balken schieben sich immer mehr vor, bilden eine Mauer, hinter der die Schützen ihre methodische Arbeit fortsetzen.
Zur selben Zeit beginnt unten die erste Massenattacke. Zwei Panzerwagen decken sechs Lastautos, die eine ganze Wolke von Grünen auf dem Pflaster abladen. Dieser Truppe gelingt es, einen Genossen von einer Abteilung abzuschneiden und nicht nur das: Ein Genosse, der seine Kämpfer um 200 Meter überholt hat, gerät in Gefangenschaft. Man durchsucht ihn und schließt ihn in einen Raum des Bahnhofs ein. Wenn die Polizei gewußt hätte, daß sie in diesem schmächtigen Mann mit den harmlosen Augen eines, der unvorsichtigerweise sich die Barrikaden ansehen wollte, die Seele des ganzen Aufstandes in ihren Händen hatte! – Von seinem Fenster aus unternahm er eine Generalprüfung der gegnerischen Kräfte. Erregte Haufen Polizisten zogen an ihm vorüber, sie munterten sich mit Schießen und Schreien auf, stürzten alle vier Schritte auf den Bauch, hinter den phlegmatischen Panzerwagen, – einige Meter hinter dieser ihrer „Avantgarde“. Endlich verschwanden die letzten Grünen mit krampfhaften Schreien in den öden Straßen der aufständischen Vorstadt – in diesen seltsamen, völlig leeren, jedes Lebenszeichen baren, von ihren Bewohnern und Verteidigern wie verlassenen Straßen. Vier qualvolle endlose Stunden dauerte das Warten. Gegen 5 Uhr nachmittags flutet die Welle der Truppen und der Polizei lärmend zurück. Ihre Verluste sind ungeheuer.
Was bedeutet diese Stille, die ab und zu vom Aufschlagen eines Fensterflügels unterbrochen wurde, aus dem eine weiße Flagge herausgehängt wurde – die Bitte, einem Verwundeten oder Sterbenden zu Hilfe zu kommen.
Indessen ist das schweigsame Barmbeck, auf das sich die Dämmerung wie ein nebliges Bettuch senkt, – in aller Stille in zwei Hälften zerschnitten worden. Anderthalbtausend Mann regulärer Truppen schneiden das nördliche Barmbeck von dem südlichen ab. Die Stützpunkte – die Wagnerstraße, das Revier Nr. 46, der Bahnhof Friedrichstraße, Pfennigsbusch strecken in der Dunkelheit geräuschlos einander die Arme entgegen. Wie es eine Polizeikette zu tun pflegt, die eine harmlose Straßendemonstration zurückzudrängen sucht.
Und auf einmal ist der elastische Ring geschlossen, der mit Panzerwagen wie mit trüben Steinen geschmückt ist, – dicht schließt sich der Kreis den Barrikaden an. Ein fester Knäuel schiebt sich vor die Kehle Barmbecks. Es ist wahr, unsere Posten sind noch auf ihren Plätzen. Aber die Tageszeit ist gegen sie. Der Gegner gewinnt mit jedem Tropfen der Finsternis, die die Nacht gewaltsam in den dunklen zusammengebissenen Rachen der Vorstadt eingießt.
Endlich sind die Weißen ebenso unsichtbar und also auch unverwundbar wie die Aufständischen. Aber ihrer gibt es viel mehr.
Eine der Straßen entlang, an ihren beiden Seiten, kriecht im Gänsemarsch eine Doppelkette von Patrouillen. An einem Hoftor packt der diese Kette führende Offizier einen mageren harmlos aussehenden Mann und richtet seinen Revolver gegen seine Brust. Und er sieht nicht den zweiten, der mit dem Gewehr in der Hand in die Dunkelheit zurückweicht. Zum zweiten Mal hielten die Landsknechte die Feder des ungestümen Barmbeck in ihrer Hand und ließen sie sich entgehen.
Eine halbe Stunde darauf gab er seinen Schützen den Befehl, zu verduften, aus diesem Barmbeck zu verschwinden, das von einem Strom unsichtbarer Feinde umringt und erdrosselt war.
Ein jeder suchte sich selbstständig seinen Rückzugsweg; die meisten nahmen den Weg über das Gebirge – über die Höhenzüge der Dächer, an den Abgründen dieser künstlichen städtischen Alpen vorbei. Am nächsten Morgen trafen alle 35 Mann im nördlichen Barmbeck zusammen, – sie beschossen, sich auf den breiten Halbkreis des Eisenbahndammes zu stützen. Wieder stundenlange Kämpfe, Barrikaden und viele, sehr viele niedergeworfene Feinde. Fünfzig Büchsen fallen ihnen zu, – leider sind es nur Scheibenbüchsen aus dem nahegelegenen Schützenklub. Drei Attacken werden zurückgeschlagen, drei Banden ziehen sich mit zerschlagenen Köpfen zurück. Den Roten kostet dieser Tag vier Leute. Vier ausgezeichnete Genossen; außerdem hat der alte Levin einen schweren Blutpreis bezahlen müssen. In seinem Garten wurden diese Knarren, diese Scheibenbüchsen aus dem Schützenverein gefunden. Der alten Frau Levin – in ihrem Häuschen mit den altmodischen Kommoden, mit dem Kater, einer weißen Ziege, mit dem Bilde des alten Liebknecht und einer fast hundertjährigen atheistischen Tradition – brachte man zuerst den blutbefleckten Mantel des alten Mannes und dann den vollständig verbluteten Körper. Dann erschien der älteste Sohn, Philister und SPD.-Mann, um in Kisten und Schränken zu wühlen, das Hab und Gut zu verkaufen und von der alten Levin irgendeine Unterschrift zu verlangen. Und sie dachte nur an das eine – wie der Alte auf dem Lastauto, allein in einem Haufen von Grünen stand und wie bleich er war.
Hier, am Abend des 24., erfuhren die Genossen fast gleichzeitig von dem Sturz Schiffbecks und von der im übrigen Deutschland herrschenden Ruhe.
Mittwoch, den 24., sah sich die leitende Gruppe gezwungen, das Rückzugs-Signal zu geben, – nicht, weil die Arbeiter geschlagen wurden, sondern weil von einer allgemeinen deutschen Revolution keine Spur zu sehen war. Welchen Zweck hätte es gehabt, den Kampf in Hamburg fortzusetzen, der einsam entbrannt war.
Aber es ist nicht so einfach, den Rückzugsbefehl in einer siegestrunkenen Stadt zu geben, in der die Verteidigung jeden Augenblick zum Angriff übergehen kann, wo es Hunderte von Barrikaden gibt, wo die Arbeiterschaft sich zum allgemeinen Angriff, zum letzten Akt des Bürgerkrieges – zum siegreichen Ergreifen der Macht vorbereitet. Den ersten Kurier, der den Rückzugsbefehl auf die Barrikaden brachte, warf man mit einer gewaltigen Ohrfeige zu Boden. Es war ein alter, ehrlicher Arbeiter, der während des ganzen Aufstandes zusammen mit seiner Familie den gefahrvollen Kurierdienst geleistet hat. Dieser Genosse wurde blutrot, wie seine zerschlagene Wange, wenn er an diese Ohrfeige zurückdachte, die er so unverdient von seinen Genossen erhalten hatte. Das ganze Arbeiter-Hamburg griff sich wie er an die Wange und biß die Zähne im Schmerz zusammen, als es den Befehl erhielt, den Aufstand zu liquidieren.
Man mußte ein solches Vertrauen bei den Massen genießen, wie es die Hamburger hatten, die zusammen mit ihren Organisationen aufgewachsen, untrennbar mit ihrem proletarischen Kern verknüpft waren, um eine solche plötzliche Wendung, wie es die Demobilmachung war, ungestraft vollführen zu können.
Nun, man zog sich zurück. Mit Aerger, murrend, – zum Abschied warf man dem Gegner weit von den Barrikaden zurück. Die Schützen benützten die dadurch geschaffene Verwirrung bei dem Feinde, verließen geräuschlos ihre Gräben, Barrikaden und Wachtposten. Man zog sich mit Waffen zurück, nahm Verwundete und Tote mit sich, verwischte alle Spuren hinter sich, zerstreute sich nach und nach in den stillgewordenen Vorstadt-Straßen. Dieser planmäßige Rückzug vollzog sich unter der Deckung von Schützen, die auf den Dächern postiert waren. Keiner von ihnen verließ seine luftige Barrikade, ehe da unten in der Tiefe der Straße der letzte Kämpfer seinen Schützengraben verlassen hatte, ehe der letzte Verwundete, von den Genossen gestützt, im Torbogen eines sicheren Hauses verschwunden war. Den ganzen Tag hielten sie sich noch, schlugen die Weißen zurück, liefen von einem Stadtviertel zum anderen – auf steilen Dächern, die über Abgründen hingen, an gähnenden Untiefen der Höfe und an den Dachfenstern vorbei, durch die die Polizei immer hartnäckiger vorzudringen begann, denn sie bemerkte endlich die Leere und die Niederlage hinter den menschenleeren, schweigenden Barrikaden. Der Kampf verwandelte sich in eine Verfolgung. Die ganze Bevölkerung versteckte und rettete die heroische Nachhut des Hamburger Oktobers, diese verwundeten, gehetzten Einzelkämpfer, die noch immer schossen, hoch oben über der Stadt, die plötzlich in unbekannte Arbeiterheime einbrachen – mit blutenden Händen, zerfetzt, mit schwarzen verdorrten Lippen, mit einer Verfolgerschar hinter sich, die fluchend, dröhnend an der eben zugeschlagenen Tür suchend vorbeirannte.
Als einer der letzten zog sich ein alter Arbeiter zurück, – wankend vor Erschöpfung, zerfetzt, trunken vor Müdigkeit, der sich nicht mehr an die glatten Dachziegel der Kamine klammern konnte. Bereits unten angelangt, im Schatten eines Hoftors, das ihm den Weg zur Freiheit wies, blieb er nochmals stehen, warf sein Gewehr hoch, um mit Wut und Genuß seine letzten Patronen abzufeuern. Die ganze Mauerecke, an die er sich lehnte, war von den aufschlagenden Kugeln zerschossen. Es war ein blinder Zufall, daß keine dieser Kugeln seinen Kopf berührt hat, der wie ein Schattenriß umlocht war. Nur mit der größten Mühe gelang es, ihn im letzten Augenblick fortzuschaffen. Um seinen Hals, über dem offenen Hemde und der verschwitzten, behaarten Brust, hing ein funkelnagelneuer, bunter Schlips.
„Mensch, wozu brauchst Du diesen Schlips?“
„Ich wollte festlich sterben.“
SCHIFFBEK
IV.
Unweit von Hamburg, dort, wo die langweilige Kette der Telegraphenpfosten nach der Seite des flachen, nackten, sandigen Preußen marschiert, liegt ein Arbeiterstädtchen mit dem Namen Schiffbek. Es dehnt sich zwischen dem Flüßchen Bille, einem trüben, wie geschmolzenen Blei glatten Wasser und einer Reihe von Hügeln aus, auf denen vereinzelte Bäume wachsen, die wie zerzaust in den Wind hinausgelaufen scheinen; zweistöckige wie hingeworfene Häuschen der Arbeitersiedlung suchen Schutz unter diesen Bäumen.
In der Mitte der Siedlung, wie ein rostiger Regenschirm, der mit dem Stiel nach unten zum Trocknen dasteht, erhebt sich die stets leere evangelische Kirche. Die internationale Bevölkerung des Arbeiterstädtchens pflegt sie nicht zu besuchen, da sie nicht an Gott glaubt. Jetzt, nach den Kämpfen, steht die Kirche ohne Türen mit eingeschlagenen Scheiben da wie ein Pfarrer, der sich verirrt hat und in fremde Hände geraten ist.
Auf der kleinen Insel jenseits der Bille befindet sich eine große chemische Fabrik – kalt, giftig, voller Kristalle, die sich im schwarzen, eiskalten Wasser bilden, voller Naphthalin und grüner Gifte, die ihren Fußboden wie mit Grünspan überziehen. In dieser Fabrik sind etwa tausend Arbeiter beschäftigt.
In den nie erkaltenden Feuerungen sprühen Flammen, dick wie geschmolzene Planeten. Sie werden durch kleine Fenster beobachtet. Zuweilen ist die weiße Glut mit leichtem Kohlendunst überzogen, aber meistens ist sie weiß und regungslos wie die Blindheit. Aus der Glut des Kesselraums stürzen die Arbeiter bis zu den Hüften nackt hinaus, in den Frost, in Schnee und Regen, – nur um für einen Augenblick dieser glühenden Atmosphäre zu entgehen, in der gigantische Schachtelhalme wachsen und sich wohlfühlen, in der die Bewohner der tropischen Sümpfe gedeihen könnten.
An der einen Seite des Steinkorridors liegt eine Dampfmühle, an der anderen ein ungeheures Eisenwalzwerk. Sein Schornstein, der länger als alle andern ist, erinnert an einem Tage des Jahres, in der Weihnachtsnacht, an einen finsteren Raucher, dem plötzlich der Tabak ausgegangen ist.
Die „Bleihütten“ liegen am Rande von öden Bauplätzen, die jetzt weiß und kalt sind. Dieses Werk hat nur einen langen, beinlosen Körper, der mit dem Bauch auf der Erde liegt, und sieben gleich lange Schornsteine, die in gleichmäßigen Abständen wie Minaretts sich erheben, von denen jeden Morgen das durchdringende Muezzin der Arbeit erklingt.
Die Arbeit in dieser Fabrik ist außerordentlich schädlich für die Lungen. Die Stärksten halten nicht länger als vier Jahre darin aus. Und man muß ein Bursche sein wie X., ein Held des Oktoberaufstandes um nach einer mehrjährigen Arbeit in dieser Hölle heil aus ihr hervorzugehen. Aber er ist ja auch ein Recke, stämmig und breitschultrig, mit einem Brustkasten, wie ihn nur lange Seefahrt und die harte Arbeit eines Seemannes hervorzubringen vermögen.
Oberhalb des Billestroms stehen die rauchigen Türme der „Jute“, eine der größten Manufakturen von Hamburg. In ihr arbeiten vorwiegend schlecht bezahlte Frauen, die schlecht organisiert sind, um derentwillen die Partei jahraus, jahrein einen erbitterten Kampf mit den menschewistischen Gewerkschaftsverbänden, mit der erstaunlich hitzigen, lauten, sehr leicht einzuschüchternden Zurückgebliebenheit der Frauen, mit dem Unternehmer und dem Pfarrer führt.
Die Frauen der „Jute“ leisteten jeder festen, straffen Organisation hartnäckigen Widerstand. Wo es nur möglich war, klammerten sie sich an die Arbeitslöhne; gleich nach den ersten Streiktagen gingen sie heulend zum Direktor, um sich mit ihm zu versöhnen; sie zertrümmerten die Fenster im Fabrikbüro, um nachher die Rädelsführerinnen auszuliefern. Der normale Prozeß des kapitalistischen Wirtschaftsbetriebes in der Fabrik pflegt indes von selbst aus diesen verwirrten, anspruchslosen, für die Ausbeutung wie geschaffenen weiblichen Massen die ersten Fäden einer kräftigen proletarischen Solidarität herauszuspinnen. Wie nachgiebig die Arbeiterinnen auch sein mochten, – ihr Arbeitslohn sank immer tiefer und tiefer. Bald die eine, bald die andere Abteilung mußte sich den Druck der spekulativen Tarife gefallen lassen. Im Bereich ihrer eigenen Fabrik – sind die Frauen ebenso solidarisch, als sie der politischen Bewegung, die sich außerhalb dieses Bereichs abspielt, gegenüber gleichgültig sind. Sie können einem Generalstreik nicht die mindeste Aufmerksamkeit zuwenden, aber sie werden ihre Kolleginnen aus der Nebenabteilung niemals im Stich lassen. Und das führt dazu, daß die ihrem Wesen nach friedliebende „Jute“ Gott sei Dank schon über ein Jahr nicht mehr als drei Tage in der Woche arbeitet, die übrige Zeit sitzt sie gemeinsam mit der jeweils streikenden Abteilung auf dem Straßenplaster.
„Oha!“ (Es ist ein Lieblingsausdruck eines jeden echten Hamburgers.)
„Oha!“ sagen Arbeiter, die seit Monaten in der „Jute“ Propaganda treiben, „der Hunger wird aus ihnen gute Kommunistinnen machen!“
Da ist zum Beispiel eine erstaunliche Frau, die aus der „Jute“ hervorgegangen ist. Wir wollen sie Frieda nennen, mag sie die Tochter eines Nachtwächters in Schiffbek sein. Ihr Vater war als rechtgläubiger Menschewist und Besitzer eines ausgezeichneten Karabiners stadtbekannt, mit dessen Hilfe er in den ihm anvertrauten Baustellen und Häusern – von den Arbeitern „Hundebuden“ genannt – Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten wußte.
Aber wenn der Nachtwächter und sein Karabiner das Recht des Privateigentums treu bewachten, so verstand es Elfriede mit ihrer erstaunlichen Schönheit diese geheiligten Grundfesten auf jede Weise anzugreifen und zu ignorieren.
Elfriede ist nicht nur eine ausgezeichnete Kommunistin, ein prachtvoller Kamerad, ein heroisches Mädchen, das auf den Barrikaden gekämpft und die gesamte weibliche Bevölkerung von Schiffbek zu der Einrichtung einer Feldküche herangezogen hat. Sie brachte den Kämpfern heißen Kaffee und frische Patronen in die Schützengräben, sie schloß ihren Alten eigenhändig ein und bereicherte die kärglichen Waffenvorräte der Partei mit seinem altmodischen Karabiner. Sie wurde von der Polizei bei ihrer verbrecherischen Tätigkeit ertappt und gefangengenommen – mitten im Kartoffelschälen, mit hochgekrempelten Aermeln; mutig, tätig, der Partei für immer ergeben, ist sie vielleicht einer der ersten Menschen vom jenem neuen und kühnen Typus, den der neuproletarische Roman so ungeschickt nachzuahmen versucht und den die Prediger der Alkovenrevolutionäre zu imitieren bemüht sind.
In das Bettlerviertel von Schiffbek kam mit ihr ein Geist der Zerstörung und der Freiheit. Elfriede weigerte sich, irgend jemandes Frau zu sein. Ihr Name weckte furchtsame Achtung bei den einen und einen wilden Haß bei den gesetzlich angetrauten Gattinnen, denen sie seit Jahr und Tag Männer, Väter, Geliebte abspenstig machte. Sie eroberte jenen, den sie sich auswählte; sie liebte ihn, solange die Liebe ohne Lüge war, um dann ihrem Gefangenen mit hochmütiger Geste seine Freiheit wiederzugeben. Aber niemals hat sie versucht, für sich oder ihr Kind Namen, Schutz, Hilfe zu erlangen. Niemals machte sie den Versuch, in einem schwachen Augenblick oder einem Krankheitsfall sich auf das Gesetz zu stützen, das sie ihr ganzes Leben lang ignoriert hat.
Aus der Werkstatt kam sie ins Gefängnis.
Aber vorher möchte ich noch von einem erstaunlichen Augenblick berichten, von einer herrlichen Szene, die sich wirklich im Korridor des Hamburger Rathauses abspielte, wohin im Oktober 1923 die verhafteten Kommunisten gebracht wurden.
Das war an jenem furchtbaren Tage, als beim Eingang des Schiffbeker Polizeireviers Lastautos standen, die mit liegenden gefangenen Arbeitern – drei, vier fünf Schichten aufeinander! – beladen waren.
Es waren Aufständische! Sie kämpften im offenen Kampfe, nach allen Regeln eines ehrlichen Krieges, – sie setzten ihr Leben gegen das Leben eines hundertfach stärkeren Feindes ein, – und doch schonten sie die Gefangenen und ließen die Verwundeten frei. Aber die Gegenseite verfuhr mit ihnen nach ihrer Niederlage wie mit gefangenem Gesindel, wie mit außerhalb der Gesetze stehenden Banden. Die Polizei stampfte mit den Füßen auf diese Reihen aufeinandergeschichteter, blutender, erstickender Körper. Zu unterst lagen Menschen mit dem Gesicht an die mit Kohlenstaub bedeckten Bretter gepreßt – sie starben, von der Schwere der auf ihnen liegenden Genossen erdrückt, während oben die Wachtmeister der Reichswehr den Gefangenen Haarsträhnen ausrissen und mit dem Gewehrkolben die Hinterköpfe der gefesselten, ohnmächtig gewordenen Menschen zerschmetterten.
Dort wurden drei zu Tode gedrückt. Aber darüber später. – Ich möchte Schiffbek nicht mit der Schilderung der von der Polizei begangenen Bestialitäten beginnen. Sie sind nur ein schmutziges, blutiges Epilog der drei Aufstandstage, die kein Soldatenstiefel aus der Geschichte der neuen Arbeitermenschheit herausstampfen kann. Auf welch unerreichbarer, geheiligter Höhe steht der Kampf des Arbeiter-Hamburgs über den blutbespritzten Fußböden der Polizeireviere, über den Tischen der Gerichtsstuben, auf denen Protokolle geschrieben, Menschen gezüchtigt und wieder Protokolle geschrieben wurden, über der stickigen Luft der Toiletten dieses vielgerühmten Rathauses, wo man die Verhafteten zwang, sich zu waschen und sogar Duschen zu nehmen, – damit die Vertreter der örtlichen Regierungsgewalt, die Herren sozialistischen Abgeordneten – die erschienen sind, um sich von der guten menschlichen Behandlung der Gefangenen seitens der Polizei zu überzeugen –, beim Anblick des verschmierten Blutes oder dem Geruch von Kleidung eines Jungen, eines Mitglieds der Kommunistischen Jugendgruppe von Hamburg, der so verprügelt wurde, daß er über seine physiologischen Funktionen die Kontrolle verlor, – nicht seekrank wurden.
Also in diesem langen, weißen Korridor, wo die betrunkene Soldateska das lebendige Stück Revolution Spießruten laufen ließ, wo die Menschen vor Schmerz und Verzweiflung gegen die Wände rannten, wo es nach nach Gummi und Blut roch, – in diesem Korridor wurde Elfriede, die die Würde ihres einsamen Lebens mit solcher Mühe und Sorgsamkeit zu wahren wußte, die, der Stütze irgendeiner offiziellen Moral beraubt, dennoch gerade und klar wie ein Kompaßpfeil war, – in diesem Korridor wurde sie dem Gestank der übelsten Verhöhnung und der schlimmsten Beschimpfungen ausgesetzt.
Alle Viertelstunde stürzte eine neue Reichswehrbande in den Saal, zerrte an der auf dem Boden Liegenden herum, bis sie wieder zum Bewußtsein kam, um wieder über sie herzufallen, mit Gummiknüppeln zu Boden zu schlagen. Und jede dieser Banden fiel mit ihren Flüchen über die Frau her.
Man schrie ihr zu: „Kommunistische Hure!“
Man schrie ihr zu: „Käufliche Kreatur!“
Man schrie ihr zu: „Du bist keine deutsche Frau, die bist eine Hündin!“
Unter diesem Entsetzen, in dieser Folterkammer, die einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag dauerte, – besann sich dieses Mädchen darauf: es hat doch eine große deutsche Frau gegeben, gewaltig wie Marmor, und nach ihrem furchtbaren Tode hatte die deutsche Revolution nichts Tragischeres und Größeres mehr aufzuweisen.
Und weiter: sie hinterließ ein kleines Buch mit Briefen. Ein weißer Umschlag und rote Buchstaben. Briefe aus dem Gefängnis.
Rosa Luxemburg.
Elfriede stand in der Hölle des Korridors und schrie Worte von Rosa Luxemburg hinein, bis man sie hörte. Wenn ein Mädchen sich mit Rosas Namen bewaffnet, dann ist es stark und gefährlich wie ein Bewaffneter – sie ist dann ein Krieger, den niemand mehr anrühren darf.
Es war unmöglich, herauszubringen, welche Worte sie hinausschrie.
Aber irgendein Unteroffizier entschuldigte sich.
Eine der Banden machte sich mit eingezogenem Schwanz aus dem Staube; einige sagten – „sie hätten nicht gewußt …“ Vielleicht ist einer der Verwundeten auf diese Weise aus den Fäusten der Soldaten befreit und gerettet worden.
Das – von Elfriede aus Schiffbek.
PORTRÄTS
V.
1. Zwei.
Ein Paar. Man erzählt, – in Schiffbek hätten zwei gelebt: ein Arbeiter und seine Frau; beide gute alte Kommunisten. Sie gingen vor einigen Jahren auseinander, ein jeder lebte sein eigenes Leben in einer neuen Familie, ohne einander zu begegnen. Im Oktober kämpfte er, als ausgezeichneter Schütze, der er war, in einem der Schützengräben, die die schmalen, nackten Straßen der Stadt überquerten. Da ereignete es sich, daß seine erste Frau neben ihm stand und an seiner Seite kämpfte. Wie früher – in den Tagen des Spartakus-Aufstandes und des Kapp-Putsches. Der Arbeiter wurde gefangengenommen – seine Frau ließ sich am nächsten Tage verhaften. So hat sich dieses Kämpferpaar wie von selbst beim ersten Schuß wiedergefunden. Sie werden zusammen abgeurteilt werden.
2. Ein eigenes Häuschen und der Aulstand.
Sie war keusch, einfach, bigott und altjüngferlich. Er wurde gleich nach dem Kriege ein Kommunist. Ein erstaunlich unternehmender, tatkräftiger, entschlossener Parteiarbeiter. Er schloß sich der Partei an, wie jene kleinen elektrischen Batterien, – die leuchten, einen Messerschleifer drehen, eine Spielzeugeisenbahn auf einem schleifenförmigen Gleis antreiben können, – sich dem Haushalt anschließen und doch Miniaturen eines ungeheuren energischen Wunders bleiben, – des Motors der ganzen Maschinenepoche; aber nur – im Tropfenmaßstabe. Wenn es nötig ist, vermag die Batterie echte, sprühende Funken zu erzeugen, die größer sind als sie selbst.
Diesen tatkräftigen und feinqualifizierten Arbeiter traf, wie eine seltsame, sehr seltene und daher unheilbare Krankheit, – eine große und qualvolle Liebe zu der frommen, ungeschlachten Jungfer.
Beide unterlagen gleichzeitig – wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt – demselben Krankheitsanfall.
Sie heirateten und übersprangen so ohne viel Bedenken seine Politik und ihren Katechismus, – sie vergaßen sie sogar eine Zeitlang ganz. Dann begann der immer eifrige, stets treu zu der Partei haltende Genosse Geld zu sparen und an der Peripherie der Vorstadt sich ein eigenes Heim einzurichten.
Er arbeitete wie ein Pferd, machte Ueberstunden, – um sich das Geld für die Einrichtung zusammenzusparen.
Das erste Kind kam zur Welt, – ein zweites. Die Partei versank im Nebel, wurde zur theoretischen Weltanschauung, zu einem Gedanken, eingeschlossen im luftleeren Raum.
Zuweilen, in Stunden der häuslichen Ruhe, vernahm er ihr stilles Nahen, ihr Horchen an der Tür seines Gewissens.
Die arbeitsame Frau lebte nun endlich in ihrem eigenen Hause, nähte an ihrem blank geputzten Herd, schlief in ihrem eigenen Bett, zog ihre Kinder groß, wusch die Kacheln des weißen Ofens, wusch ihre Ferkel, wusch die blanken Dielen. Des Sonntags las ihr Mann einen Roman über ein verwöhntes und verdorbenes gräfliches Kind aus dem Hofleben vor; das Buch endete mit einer Heirat.
Am 23. Oktober frühmorgens schlachtete man gerade ein Schwein zum Weihnachtsfest. Das Blut war schon im Faß aufgefangen – für die Blutwürste. In diesem Augenblick begann das Schießen in der Stadt. Trotzdem er ein Heim besaß, trotz seiner außerordentlichen Liebe zu seiner Frau – nahm der Kommunist sein Gewehr und ging fort. Was geschah nun weiter?
Er wurde gefangengenommenen, verprügelt und wieder freigelassen. Einige Tage später sollte er abgeurteilt werden. Was tun: zu Hause bleiben oder flüchten?
Derselbe mächtige, revolutionäre Instinkt, der ihn auf die Barrikaden hinausgetrieben hatte, der diesen verbürgerlichten, zahmen deutschen Arbeiter, der gut und satt gelebt hatte, – auf die Straße, in den Kugelregen gegen die zweitausend regulären Soldaten hinausgetrieben hatte, – dieser erbarmungslose Klasseninstinkt befahl jetzt: – die Partei nicht mehr zu verlassen, nicht zu desertieren, er mußte von jetzt ab illegal leben und weiter arbeiten.
Aber am nächsten Tage nach seiner Flucht wird sein gesamtes Hab und Gut, sogar der Wachhund Lumpi, von der Regierung konfisziert werden. Die Frau mit den beiden Kindern und mit dem dritten, das eben erst geboren war, wird man auf die Straße werfen. Außerdem nimmt die Gesundheit und Arbeitskraft seiner Frau gerade jetzt rapid ab; sie hat wieder angefangen, oft und lange zu beten.
Und dennoch kam sie mit ihren Kindern eines Tages zu einem Genossen; die Frau erzählte diesem ihr ganzes Leben und sogar von jenem ersten Blick, den sie und ihr Mann einmal gewechselt und der über ihr Schicksal entschieden hatte.
Am nächsten Tage ergriff X. die Flucht.
3. Das 18. Jahrhundert, die Freude des Lebens und der Aufstand.
Im Grunde genommen gehört dies Porträt nicht zu der eigentlichen Geschichte des Aufstandes. Aber in jeder Galerie gibt es unbedingt ein „Bildnis eines Unbekannten“, und oft spricht eine solche namenlose Arbeit weit mehr von den Besonderheiten ihrer Zeit, als alle gezeichneten Kunstwerke.
Es muß ein Haus gezeichnet werden, das wie ein versunkenes Schiff irgendwo in der Tiefe einer dunklen Gasse langsam zerfällt, wo es von Zeit zu Zeit von den weißen Augen eines vorbeischwebenden Autos beschienen wird. Die Laterne über dem Hoftor scheint so trübe, daß sie an das Leuchten des faulenden Holzes erinnert.
Ein übelriechender Hofeingang, die Fenster sind so tief über der Erde, daß ihre Bewohner stets belauscht werden können.
Das Schlafzimmer, kalt wie der Nordpol, mit seinen verglasten Scheiben, einem Schrank und außer Gebrauch stehendem Waschtisch, wird nur von einer Wärmflasche erwärmt, die man unter das eisige Federbett steckt. Im Speisezimmer – es ist auch das Wohnzimmer und die Werkstatt zugleich – herrscht die vergängliche Gluthitze eines kleinen Kanonenofens; auf die Lampe ist ein seidener Schirm gestülpt, der an den Unterrock einer armen Prostituierten erinnert; in der Küche – ein stinkender Ausguß, Geruch von Gas und Feuchtigkeit. Diese ganze Einrichtung zeugt von dem zweifellosen Wohlstand eines Arbeiteraristokraten, sie gehört dem Genossen Y. Er ist in einer der größten Möbelfabriken beschäftigt, die altertümlichen Hausrat macht oder nachmacht. Seine Spezialität ist das 18. Jahrhundert, das er, ohne jemals etwas darüber gelesen zu haben, in seinen Fingerspitzen fühlt. Mit geschlossenen Augen kann der Meister tadellose Intarsienarbeiten aus kirschrotem Holz mit Einlagen aus Metall und Perlmutter zustandebringen; aus feuchtem, schwerem Tannenholz schaffen diese schöpferischen Hände komplizierte, träg gebogene Umrisse zarter Möbel – ebenso leicht und gut, als wenn sie in den Werkstätten des vielgerühmten Boule entstanden wären. In jedem der altmodischen Sekretäre, auf dem die Großmütter angeblich ihre Liebesbriefe zu schreiben pflegten, in jedem der L’Hombretische, auf denen die Werthers die Namen ihrer Geliebten mit Kreide zeichneten, – richtet Meister Z., um den Stil zu wahren, Geheimfächer, kleine Schubladen, verborgene Federn ein, die, wenn zufällig berührt, den Händen eines entzückten Bourgeois ein paar vergilbte Zettel, ein Bündel Vergißmeinnicht und das feine Aroma eines fremden Geheimnisses ausliefern. Meister Z. bringt das alles mit ungeheurem Geschmack und sicherem Maßempfinden an.
Und auch in ihm selbst ist der Kommunismus wie in einer Geheimschatulle verborgen, die voller Ideen, Worten und Verallgemeinerungen ist, die im praktischen Leben vollkommen unanwendbar, doch das Wertvollste und Intimste im Menschen sind – sein politischer Stil.
Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß Z. an dem Aufstand keinen aktiven Anteil nahm, –abgesehen natürlich von einer weitgehenden Gastfreundschaft, die er den Genossen nach den Kämpfen erwiesen hat.
Z. ist ein Epikuräer. Ein echter Renaissance-Mensch in seiner unaufhaltsamen Liebe zum Leben, ja, – zu Genüssen und in dem Gefühl für die warme, menschliche Schönheit, für die er einen ebenso sicheren Instinkt hat wie für seine Kunsttischlerei. Z. glaubt, daß der Lebensprozeß selbst mit allen seinen physiologischen, sehr irdischen Verrichtungen einmal die Grundlage für die größte und realste Schönheit abgeben wird. Diese soziale Aesthetik macht ihn mit dem Besten verwandt, was Edgar Poe über die noch nicht existierenden Schlösser und Gärten geschrieben hat, in denen Weise und Dichter leben sollten. Z. bevölkert sie mit Arbeitern.
„Wenn einmal das Reich der Zukunft zustandekommen sollte“ (Reich der Zukunft – ein echt
deutscher Ausdruck: so kann sich nur ein Utopist ausdrücken, der an seinen Traum nicht glaubt), – würde er herrliche Betten, Tische und Stühle für die Schlösser der Arbeiter bauen. Das ist seine ideale, seine kommunistische „Schatulle“.
Jetzt die Praxis. Warum hat er im Oktober nicht mitgekämpft? Warum lächelt er, wenn von Streik und Verteilung von Aufrufen gesprochen wird? Woher hat er, bei dieser durchdachten Passivität, bei seiner zweifellosen Flucht vom Felde des Bürgerkrieges, – diesen herausfordernden Hochmut und das Aussehen eines Siegers der Bourgeoisie gegenüber? Warum hat dieser Mann, der geschaffen ist, große geistige und körperliche Freuden zu genießen, der den Kommunismus für den einzigen Weg hält, der ihn und seine Klasse zu diesen Genüssen führen kann, – warum hat er während der ganzen Zeit des Aufstandes keine Hand gerührt, kein einziges Mal seinen Kopf riskiert?
Es stellt sich nun heraus, daß der Mann stiehlt, daß er seinen Bourgeois bestiehlt. Er tut es fast offen, steckt sich verhältnismäßig bedeutende Summen in die Tasche, sieht seinen Arbeitgeber dabei herausfordernd an, ohne seine ängstlichen Helfershelfer aus den Augen zu lassen.
Dann, nach Wochen der härtesten Arbeit mit einem zehnstündigen Arbeitstag und ununterbrochener Nervenanspannung: – einige Flaschen des besten Weins, seine kleine Frau, in schwarzer seidener Wäsche, – und aus seiner stinkenden Ecke, wo der Kork einer Roederer-Flasche gegen die niedrige Zimmerdecke knallt, gegen die jeder groß gewachsene Mensch stoßen würde, durch den Dunst einer guten, starken Zigarre, durch den Nebel der durchwärmten Feuchtigkeit, durch die goldenen Illusionen, die in kleinen Blasen auf der Oberfläche des gefüllten Tonkruges aufsteigen, in dem hundertjähriger Traubensaft zischt, – betrachtet Z. mit dem spöttischen Lächeln eines Siegers die von ihm so schlau und kühn betrogene Bourgeoisie.
Das sind seine besten Stunden.
Die alten Hamburger Lieder sind älter und trunkener als unsere. Es ist in ihnen von einer Meisterstochter die Rede, die drei wilde Gesellen liebte, von Seerosen und Frauen, von Händeln und Hafenkneipen. Er singt sie herrlich.
Wie soll man es ihm klar machen, daß er für das Wenige, das der Arbeitgeber ihm, dem unersetzlichen Meister, von seiner reichlichen Tafel gönnt – für einen Tropfen gestohlenen Weines, für einige Stunden einer seligen Selbstvergessenheit –, er seinem Feinde ebenso wie die andern den Saft seines Lebens und das Leben selbst abgibt, das geheimnisvolle, schöpferische Zucken seiner Gehirnzellen, das man Talent nennt, – daß er, ebenso wie jeder Arbeiter, – seinen Schweiß, seine Muskeln, seine Knochen dafür opfert?
WIEDER SCHIFFBEK
VI.
Das Polizeirevier von Schiffbek, sein Gemeindehaus, die Post und überhaupt alle Behörden und öffentlichen Einrichtungen, die die Staatsgewalt in diesem Arbeiterstädtchen mit der internationalen Bevölkerung verkörpern, – wurden von Kommunisten frühmorgens am 23. Oktober mit Hilfe eines Karabiners und eines Jagdmessers mit einem Horngriff und stumpfer Klinge in Besitz genommen.
Das Polizeirevier in Schiffbek wurde wie in ganz Hamburg überrascht, mit nackten Händen schnell und geräuschlos besetzt, obwohl es mit bewaffneten Sipoleuten vollgepfropft war. An der Spitze des ganzen Aufstandes und der militärischen Organisation, die den Plan ausgearbeitet und ihn durchgeführt hat, stand X., Ein tapferer Mensch, einer von jenen echten Arbeiterrevolutionären, auf die das zeitgemäße Deutschland stolz sein kann. Vielleicht waren es gerade die ungeheure physische Kraft, das Bewußtsein, daß er mit einer einzigen Bewegung seiner metallischen Muskeln
jeden Gegner zermalmen kann, die in ihm das für einen Führer äußerst wertvolle Gefühl für die Vorsicht, die Fähigkeit, die Folgen einer jeden Kraftentladung genau zu berechnen, entwickelt haben. Wie ein Dampfhammer, der auf einen Amboß niedersausen kann, ohne den Kern einer Nuß, sondern nur ihre Schale zu zertrümmern, hat er sich stets in der Gewalt.
Seine, bewaffente Abteilung, die aus den besten Kämpfern bestand, kämpfte so, wie X. selbst gekämpft hätte; von der angreifenden Bande umringt, nur rückwärts an eine Mauer gelehnt, schlugen sie sich standhaft und hieben die Knirpse nieder, die ihnen zahlenmäßig, aber keineswegs der Kraft nach überlegen waren.
Nachdem die Aufständischen das Polizeirevier besetzt hatten, blieben sie nicht im Gebäude, sondern verließen es mit 16 Gewehren und ebensoviel Revolvern; denn das Gebäude hätte für sie zu einer ebensolchen Falle werden können, wie für die eben erst entwaffnete Polizei.
Verborgen hinter Gestrüpp, hinter Lauben und Ecken der Arbeiterkasernen, die längs der ganzen Hügellinie verstreut sind – linker Hand von der Chaussee, die Schiffbek mit Hamburg verbindet –, konnte ein guter Schütze die Chaussee, die Brücke, den Eisenbahndamm stundenlang unter Feuer halten, den Gegner – auch wenn er zehn-, hundert- und, wie es bei den letzten Attacken am Morgen des 26. der Fall war, tausendmal stärker war – in einer gehörigen Entfernung halten. Unerreichbar hinter seiner Deckung schoß der Scharfschütze nur alle fünf, zehn, fünfzehn Minuten; er versuchte mit einer Kugel mindestens einen, oft aber auch zwei Menschen zu treffen. Die Polizei beantwortete diese einsamen, immer tödlichen Schüsse mit einem wilden Feuer, sie fegte ganze Viertel mit Maschinengewehrfeuer aus und tötete zahlreiche Frauen und Kinder, die zufällig in das Gesichtsfeld ihrer ohnmächtigen Wut gerieten. Und trotzdem pflegte nach einer kurzen Pause wieder ein kalter, durchdachter Schuß zu fallen, der dann irgendeinen Chauffeur eines Panzerautos traf, der einen Augenblick unter seiner Stahlkappe hervorsah, seine Fellhandschuhe auszog und eine Zigarette anzündete; oder einen Grünen, der hinter der Ecke hervorsprang und hinter einem Briefkasten niederhockte; oder einen Reichswehrsoldaten, der die Frau eines Straßenbahnschaffners mitten auf der Straße anhielt, weil ihr Gesicht und das unter dem Tuch versteckte Brot ihm verdächtig vorkamen.
Die Reichswehrsoldaten sind meistens unter ungeschickten Bauernburschen angeworben; es sind die jüngeren Söhne von reichen Bauern, – eine Generation, die erst nach dem Krieg und der Revolution großgeworden ist. Den Vätern fallen sie zur Last, weil sie zu träge und verwöhnt sind, weil sie, ohne in der Zukunft mit einer Erbschaft rechnen zu können, sich zu wenig um die Verbesserung der Wirtschaft kümmern. Diese Burschen lassen sich gern als Landsknechte anwerben; sie betrachten den Bürgerkrieg als eine Gelegenheit, bei der man sich ohne viel Risiko manches aneignen kann. Aber statt auf schutzlose Frauen und Kinder, die sie vor den Brotläden zu sehen gewohnt waren, statt auf feigen Stadtpöbel, von dem der Pastor mit dem dreifachen Kinn auf dem weißen Krägelchen zu Hause so viel mit schönem Pathos zu berichten wußte, – stießen diese satten Bauernburschen, die mit Blutwürsten und Milchklößen großgezogen sind, auf Arbeiterhundertschaften, auf kaltblütige, unfehlbare Schüsse der alten, aus dem Weltkrieg mit allen Auszeichnungen für Scharfschießen und Sappeurarbeiten unter feindlichem Maschinengewehrfeuer hervorgegangenen Soldaten.
Die Rollen sind vertauscht. Die Revolution in Deutschland verfügt über Stammtruppen von alten Soldaten, die ihre Barrikaden nach allen Regeln der Kriegswissenschaft verteidigen, die Regierung aber – über zahlreiche, aber ganz unerfahrene Truppen. Nicht umsonst hat einer der Offiziere, der seine Rekruten mit dem Revolver in der Hand zum Angriff gegen ein Haus treiben mußte, in dem ein Scharfschütze festsaß und unbarmherzig einen Soldaten nach dem andern niederknallte, – nicht umsonst schimpfte der Leutnant, daß man es in dem ganzen Städtchen hörte: „Ihr feiges Gesindel! … Mit zwanzig solcher Leute wie die da (eine Geste nach der Richtung zum Dachfenster) würde ich mit ein paar tausend wie ihr fertig werden.“
Aber auch ohne die Hilfe dieses Offiziers hielten die Arbeiter Schiffbeks – insgesamt 35 Gewehre – dem Angriff der regulären Truppen stand. Sich den Verhältnissen der Gegend anpassend, änderten sie fortwährend ihre Taktik. Dort, wo die Stadt von Hügeln beherrscht wird, wo die Häuser gleich Oasen inmitten offener Felder stehen haben sie ihre Kräfte in kleine Kampfeinheiten zersplittert, deren jede auf eigenes Risiko sich verteidigte, angriff, sich versteckte und ihre Deckung suchte. Aber dort, wo die öden, weißen Felder sich zu städtischen Straßen verengen, griffen sie zu der alterprobten Technik der Straßenbarrikaden; sie versperrten die Straße mit starken Dämmen, gruben Schützengräben und machten es den Panzerwagen auf diese Weise unmöglich, in die Zentralpunkte der Stadt einzudringen.
Um 11½ Uhr nahm die Polizei einen Stadtteil ein und begann ihren ersten Angriff auf Schiffbek. Eine Abteilung von 50 Mann rückte selbstbewußt in die Hauptstraße ein; sie warf einige zufällige Passanten um und näherte sich einem weißen Hause, dessen Ecke weit vorgeschoben ist. Die hübsche, braunäugige Y. ging an den Soldaten vorbei, lächelte ihnen zu und zählte sie sorgfältig. Sie bemerkten nicht einmal das rote Abzeichen an ihrer Brust. Ihr hinten zugebundenes Tuch verschwand harmlos in einer Seitengasse. Ein Knabe, ein Schüler der Stadtschule, der neben ihr herlief, sah sich um und setzte sich auf den Bürgersteig. Die Kugel traf ihn zwischen die Augenbrauen.
Im Lager der Aufständischen herrschte noch immer völlig Stille, und erst in einer Entfernung von 20 Schritt nahmen sie aus der angreifenden Abteilung den Feldwebel und die Hälfte der Soldaten heraus.
Eine Stunde später marschierte die Polizei bereits in einer Anzahl von 200 Mann auf, und nicht nur in einer Richtung, sondern gleichzeitig von mehreren Seiten. Die Arbeiter vertrieben sie von ihren Barrikaden und Schützengräben; von allen auf den Hügeln verstreuten Deckungen regnete es Schnellfeuer. Ein Scharfschütze feuerte gegen die Polizisten hinter der Ecke seiner Kaserne hervor, umringt von Frauen, die in ihren zerrissenen Schürzen Patronen bereithielten. Eine klassische Figur: eine verwegene Mütze mit einem großen Schirm, ein Halstuch unters Kinn gebunden, die Jacke in Fetzen, darunter das dicke graue Wams des Dockarbeiters. Einen Kopf hatte der Mann, an den die hübsche Y. auch jetzt noch ohne Lachen nicht denken kann, – wie ein Räuber sah der Mann aus! Und nach fünf Minuten der Erwartung fällt allemal nur ein Schuß. Mit einem seiner Schüsse warf er drei Leute um.
Es muß gesagt werden – Schiffbek ist reich und berühmt seiner Schützen wegen. Ein zweiter leitete die Verteidigung der Barrikaden und Schützengräben. Ein untersetzter Bursch, der sich tief in die Erde gräbt, irgendwo zwischen den Ufersteinen, dem Seewind ausgesetzt. Die Hacken zusammen, die Brust wie eine Trommel, die Hände in den Taschen, eine Schulter ein wenig vorgerückt – die Schulter eines trainierten Boxers und Athleten. Einen Pfiff hat der Mann, freche Scherze und die Fähigkeit, einer Frau oder einem Polizisten mit einem Blick von unten nach oben und von oben nach unten das Blut in die Wangen zu treiben. Dieser Bursche pflegte in friedlichen Zeiten die ausgeglichenen Parteibonzen mit seinem scharfen Hafengeruch und herausfordernden Benehmen ein wenig zu chokieren: aber während der Kämpfe vollbrachte er Wunder. Er stürzte von Schützengraben zu Schützengraben, trieb an, hielt zurück, fluchte, kommandierte, – er war jener Nervenknäuel, der die ruhige Kraft des X. mit dem fluktuierenden Häuflein der Aufständischen verband.
1½, Uhr nachmittags zog die Regierung gegen Schiffbek mit 500 Mann und einer Abteilung Panzerautos, Der Kampf dauerte bis 6 Uhr abends. Zwei ausgezeichnete Schützen können sich sehr lange halten; aber auch der größte Mut und die größte Ausdauer haben ihre Grenzen. Um Zeit zu gewinnen, verließen die Kämpfer in aller Stille den Schützengraben, tauchten ins nächste Hoftor unter, und eine Viertelstunde später sahen die Mündungen ihrer Gewehre aus einer anderen Barrikade hervor; so kämpften sie der Reihe nach in den gefährdetsten Rayons. Inzwischen bedeckte der verblüffte Gegner den verstummten Hinterhalt noch immer mit einem Hagel von Kugeln. Von Zeit zu Zeit läßt der Eifer der Angreifer nach; das blinde Feuern wird eingestellt, und ein Kundschafter kriecht auf allen Vieren den Bürgersteig entlang. Aber von irgendwo her, aus dem nachbarlichen Dachboden etwa, fällt ein einsamer Schuß, und die Kanonade gegen den leeren Graben voll leerer Patronenhülsen wird mit neuer Kraft eröffnet. So hat eine Abteilung der Polizei in einer der Gassen zwei Stunden lang einen leeren Schützengraben gestürmt. Endlich riß der Leutnant seinen Revolver heraus, fuchtelte mit ihm heroisch in der Luft herum und führte seine Leute in die Attacke. Blind in die Luft schießend und mit kriegerischem Geheul fielen sie in einen leeren Graben hinein.
Es begann zu dämmern. Wie ein Wachtposten ließ der Sonnenuntergang seine langen, wie Bajonette zugespitzten Schatten in alle Straßen fallen. An den Mauern von Schiffbek prangte schon ein Plakat, das den Generalstreik verkündete und die Sowjetregierung begrüßte. Die fünfunddreißig Kommunisten, die von Tausenden von Soldaten umringt waren, waren überzeugt, daß ganz Deutschland sich hinter ihrem Rücken erheben wird. Uebrigens unterstützte die Bevölkerung auch ohne alle Aufrufe einmütig die Kommunisten. Einige tausend Mann zogen durch die Straßen, und wenn sie an dem Kampf nicht aktiv teilnahmen, so doch nur deshalb, weil es vollständig an Waffen fehlte.
Und die heilige Intelligenz! Es muß hervorgehoben werden, daß ihr Vertreter im kleinen Schiffbek, wie bei uns, wie überall, wo die soziale Revolution endlich zu den Waffen greift, – gemeinsam mit der Polizei und den Soldaten geschossen hat. Es war kein Professor, – in Schiffbek gibt es keine Professoren! –; kein Lehrer – die Lehrer sind wohlgesinnt, aber ängstlich; es war keine Hebamme – in Schiffbek gebären die Frauen von selbst, ohne jede Spur von ärztlicher Hilfe. Nein, es war nur der alte Schuldiener, der sich für die Früchte der europäischen Aufklärung einsetzte. Allein, verlassen in seinem öden Gebäude, elend und kläglich mit seinen sechzig Jahren, vollgepfropft mit Schulweisheit; ein Arbeiter, der gelernt hat, schwielige Hände, Armengeruch und junge, starke Unwissenheit ebenso zu verachten, wie sie von unerbittlichen Schultafeln, Lehrerröcken und von den Weisen aus Gips auf dem Bücherschrank im Rektorzimmer verachtet werden; dieser alte Diener, der konsequenter war als Alexej Maximowitsch Gorki, ergriff eine Pistole und beschloß auf die Jungen zu schießen, auf die Schüler seiner Schule, die, statt sich mit Schönschreiben und Religion zu beschäftigen, an den Straßenunruhen teilnahmen. Ein Klopfen gegen die Tür. Der Schuldiener duckt sich nieder. Es klopft noch einmal, dann fährt die Tür aus ihren Angeln, denn V. wurde ärgerlich. Da erhebt der alte Mann pathetisch, wie das Schillerdenkmal, den Arm, drückt gegen die breite Brust des Arbeiters ab und – schießt vorbei. In diesem Augenblick nahm das Pathetische ein schnelles Ende. Der Diener schlüpft auf die Treppe hinaus, X. läuft ihm nach. Der Diener hüpft, trotz des Revolvers in seiner Hand, über die Stufen und brüllt, daß man es im ganzen Hause hört.
„Altes verrücktes Karnickel! Trägst der Wissenschaft die Nachttöpfe nach! Wozu bist du bloß auf der Welt? Und X. nahm Onkel Paulus den Revolver ab.
Der Alte weinte bitterlich, denn die langen Jahre, in denen er die Kreidealgebra und die Ziffern der Chronologie von der Schultafel wischte, haben ihn zu einem echten Intellektuellen gemacht; das zeigte sich darin, daß der Mann anfangs einem verzweifelten Entschluß unterlag, um schließlich in hilflose Tränen auszubrechen.
X. gab ihm einen Klaps und verzieh ihm. Es war sogar so: X hielt den Alten und seine unglückselige Waffe in der einen Hand und wischte sich lachend und fürchterlich fluchend den Pulverrauch von dem durch den Schuß versengten Gesicht. Paulchen sah sich gezwungen, trotz aller Tränen sein altes, geschändetes Parteibuch zu zerreißen.
Ringsherum: Jungens, Gewehrfeuer, Tod und Lachen.
Gegen Abend ließen die Kämpfe nach. Die Arbeiter waren gezwungen, sich zurückzuziehen – X. Spricht auch jetzt noch mit der größten Verlegenheit und kindlichem Schuldbewußtsein davon: die Arbeiter mußten sich fünfhundert Schritt weit von ihren alten Stellungen zurückziehen. Und zwar – nach der Hamburgischen Seite zu. Aber auch im Rücken gelang es den Truppen bis zum Hauptplatz vorzudringen, wo die reichen Stadtbewohner sie mit Bockwürsten, Margarine und Gratulationen überschütteten. Der Belagerungsring wurde immer enger, drohte zu einem Halsband zu werden. Eine Abteilung von Aufständischen, die aus dem geschlagenen Barmbeck den Schiffbekern zu Hilfe kommen wollte, war außerstande, die Polizeiblockade zu durchbrechen. Zu dieser Zeit flogen schon durch die Straßen Hamburgs Autos des Reichswehrkommandos: die Offiziere des Generalstabs beeilten sich, das Netz der Barrikaden kennenzulernen, – sie fanden ihre Anlage ausgezeichnet.
Als die Morgendämmerung einbrach, lagen die Arbeiter wieder in ihren Schützengräben, Dachböden, hinter allen möglichen Deckungen. Aber der Tags zuvor in drei Attacken geschlagene Gegner zeigte sich nicht. Irgendwo, in Fabriken, tönten zwecklos und anhaltend die Fabrikpfeifen. Am Ende einer jeden Gasse, die in freies Feld hinausging, patrouillierten Soldaten. Wie einen Gefangenen im Gefängnis bewachten sie von weitem die Barrikaden. Darauf – unheimliche Stille. Anfangs freute man sich darüber. Dann wurde es bedenklich. Man begann eine ungeheure Gefahr zu ahnen, die aus diesen schweigsamen, öden Feldern gegen Schiffbek kroch. Man bereitete sich auf ihren Empfang vor.
35 gegen 5000!
Gegen 1 Uhr mittags kam von Horn aus eine Abteilung von vier Panzerwagen und sechs Lastautos, die eine zahlreiche Sipoabteilung auf der Chaussee abluden. Von Norden her, aus Uhlenhorst, zeigen sich viele Lastautos mit Grünen. Von Eimsbüttel her – Kavallerie. Ein Flugzeug flog tief über Schiffbek hin und bestreute seine durchlöcherten Häuser mit grauem Kugelregen. Die deutsche Armee – von den Alliierten geschlagen – kämpft mutig mit ihren Proleten. Aber das Beispiel der Alliierten ist offenbar ansteckend gewesen, denn jetzt setzen auch die Proleten den Regierungstruppen hart zu. Kavallerie, Infanterie, Panzerwagen, Flugzeuge, sogar eine ganze Kriegsflotte auf der schmutzigen Bille – fünf Kutter der Wasserpolizei – und ein Häuflein von Arbeitern, das dieser ganzen Technik, diesem Aufgebot einer Söldnerarmee spottend – bis vier Uhr nachmittags standhält. Sie werfen endlich die Truppen von den ungeschützten Stellungen zurück, jagen die blauen, grünen und überhaupt farbigen Soldaten vor sich her, durchbrechen den Ring der Belagerung und gelangen durch diese blutige Bresche in die Freiheit. Es klingt lächerlich: drei Schützen bilden die Nachhut dieser winzigen Arbeiterarmee. Sie halten die „Seekräfte der Republik“ in gehöriger Entfernung, bis X. mit seinen Leuten sich durch den schmalen Spalt zwischen Fluß und Chaussee durchgeschlagen hat.
Triumph der Sieger. Denunziationen, Haussuchungen, Verhaftungen, Faustjustiz, Dankgottesdienste. Und alles das dauert fast zwei Monate. Dutzende von Arbeitern beginnen illegal zu leben. Viele sind verhaftet und erwarten ihr Urteil. Ihre Familien leben noch in den stickigen Arbeiterkasernen; die Frauen der Aufständischen werden eine nach der anderen entlassen und auf die Straße geworfen. Von Zeit zu Zeit erscheint in ihren Wohnungen ein gesprächiges Mitglied der Verwaltung des Gewerkschaftsverbandes: mit einem geschwollenen Kopf, gelb von Jodtinktur, in weißen Binden. Er wurde in den Tagen des Aufstandes irrtümlicherweise in der Nähe der Bleihütten ergriffen und von der Polizei zu Hackfleisch gemacht. Jetzt läßt er sich die ausgeschlagenen Zähne einsetzen, schnüffelt überall herum und vermittelt.
Hunger, Schnee, eisig kalte, schmutzige Betten, unerschwinglicher Mietszins, Grobheiten des Hausverwalters und ein Winter, der jeden auf dem Wege zwischen seiner schmutzigen nach Gas und Toilette riechenden Wohnung und dem Arbeitslosenbüro mit weißen Ruten züchtigt. Dieses Büro – ist ein graues Haus, das stramm steht und ins leere Feld hinaus salutiert. Der ganze Rücken dieses Hauses ist mit unseren Flugblättern beklebt.
Von Zeit zu Zeit erscheint bei den jeder Willkür, Gewalt und Entbehrung ausgelieferten Frauen ein Polizeitrupp zwecks Vornahme einer Haussuchung oder ein „Feldgendarm“ zu ihrer Vernehmung. Dann zeigt diese ganze hilflose Armut auf einmal ihre verborgenen Stacheln und setzt der zivilen und militärischen, mit ihren Säbeln über die vereisten, mit eingefrorenem Unrat bedeckten Treppen rasselnden Gewalt einen mutigen und harten Widerstand entgegen.
Die Fäuste in die Seiten gestemmt, mit einem Gesicht, rot vom Zorn, vom glühenden Herd oder vom Waschtrog, die brüllenden Kinder und den wild bellenden zottigen Hund anschreiend, die Stimme bis zur durchdringenden, bissigen Höhe steigernd, – weist die Frau eines Schiffbeker Aufständischen alle Papiere zurück, wie man über der Stirn hängende Haarsträhnen ärgerlich zurückstreicht; mit wütender Hartnäckigkeit leugnet sie alles, gibt ausweichende Antworten, unterschreibt kein einziges Papier. Und ihre Schimpfworte, unabwendbar, wie ein Topf mit Unrat, prasseln auf die Köpfe der abziehenden Beamten nieder. Diese Frauen, die nichts zu essen haben, die morgen aus ihren Löchern hinausgeworfen werden, malträtieren die Polizei, verhöhnen sie, verfolgen sie mit ihrem bissigen Spott.
Vor dem Weihnachstfeste tun sie sich zusammen, um für die Kinder der geflohenen Kommunisten ein Dutzend Puppen zu nähen. Man zimmert Puppenstuben aus alten Kisten, beklebt sie mit Zeitungen und abgegriffenen Königen und Damen aus einem alten Kartenspiel. Die hungrigen Nachbarn erscheinen mit Geschenken – mit einem Stück Seife, mit einer Puppe, mit wollenen Strümpfen.
Endlich erscheint in der Nacht ein Arbeitertrupp aus Hamburg – mit einem Handkarren, der mit Mehl und Margarine von den amerikanischen Genossen beladen ist. Fünfzig Kilo Fett und fünfundzwanzig Pfund Zucker für siebzig Familien, deren jede mindestens drei bis fünf Münder zählt.
Einige Tage vor Weihnachten erreicht der Hunger seinen Höhepunkt. Auf das Anerbieten der holländischen Gruppe der Internationalen Arbeiter-Hilfe schickt Schiffbek fünfzig seiner Kinder nach Holland, wo sie bei holländischen Genossen untergebracht werden.
Es klopft an der Tür – es erscheinen Arbeiter mit verlegenen Gesichtern, die keinen ansehen, höchstens die Wäsche, die über dem kalten Herd hängt, oder die Wand, die grün wie Syphilis ist; sie sprechen vom Wetter, von Gesundheit, von Kleinigkeiten.
Mit in sich gekehrten Augen erkundigt sich die Mutter – wen sie nun eigentlich nehmen wollten: einen Knaben oder ein Mädchen und von welchem Alter? Die Reisevorbereitungen dauern eine Viertelstunde. Gepäck gibts nicht. Dann – einige Minuten verzweifeltes Heulen auf den zitternden Knien der Mutter. Aber die Strümpfe sind schon mit Bindfaden fest zugebunden, alle Knöpfe sind sachlich zugeknöpft, und die Mutter kämmt ihrer Tochter mit schroffen, keinen Widerspruch duldenden und doch verlangsamten, insgeheim in die länge gezogenen Bewegungen den zerzausten Zopf aus. So wird das Kind in einem Zeitraum von fünfzehn Minuten oft für immer von seiner Wurzel und von dem verwüsteten Schiffbek losgerissen.
Zwei Mütter weigerten sich ihre Kinder nach, Holland zu geben.
Die eine – mit vier Knaben und zwei Mädchen belastet (der Mann verhaftet, die Fabrik hat sie entlassen, ein Fenster ist mit Zeitungen verklebt) – bringt es auf irgendeine unerfindliche Weise fertig, sechs Münder über Wasser zu halten. Eine andere – ganz Sorglosigkeit, Munterkeit, Schmutz und physische Zerstörung. Kinder von allen Schattierungen: – von den vielen heiß, aber nur kurz geliebten Vätern. Mädchen, die ungebeten zur Welt kamen, wie eine erstaunliche, goldgelbe Sonnenblumenblüte, irgendwo an der Müllgrube, aus einem zufällig auf dem beschmutzten Boden niedergefallenen Samen. Die Jungens – gesund, munter und sich selbst überlassen, die sich fest an die schimmlige, alte Fabrikmauer klammern und ihren Lebenssaft aus ihr saugen. Unter Tränen, Flüchen über die ungebetene Fruchtbarkeit, unter Kindergebrüll, nach links und nach rechts Klapse austeilend, mit einem Brustkind im Zug vor der Tür stehend, das entweder an einem Zipfel der schmutzigen Bluse oder an der abgemagerten nackten Brust saugt, – – diese Mutter weigerte sich, auch nur ein einziges Exemplar ihrer lebensfrohen, hungrigen Kinderschar in die Verbannung zu geben.
Unter diesen Familien, die in dem unterdrückten Schiffbek den Todeskampf kämpfen, gibt es eine, die dermaßen glücklich ist, daß die Nachbarinnen des Abends hingehen, um der ungewöhnlichen, dort herrschenden Stille zu lauschen. Die kleine, schwarze, früh gealterte Frau – mit den schwärzesten Augen, die es gibt, mit dem braunsten Gesicht der Welt und mit einem Knistern in der Stimme, das an etwas Südliches erinnert – an das Knistern der in Wärme und Asche bratenden Kastanien. Ihre vier Kinder sind – als wenn es abgemacht wäre – entweder ganz weiß mit Blau oder olivbraun mit Schwarz. Nach der Reihe: kleine Tschechen und kleine Deutsche. Ihr Mann, ein alter
Kommunist, wurde in der Armee für seine polnische Familie und unheimliche Schweigsamkeit, hinter der der Feldwebel den Pazifisten witterte, öfters verprügelt. Mitglied des Spartakusbundes, einer der ältesten Kämpfer der KPD., verwundet während des Kapp-Putsches.
Im Leben eines jeden Menschen gibt es Perioden, wo der Eiter anfängt, sich zu sammeln und zu reifen. Jede kleinste Unannehmlichkeit: leichte Erkrankung des Kindes, ein unangenehmes Gespräch mit dem Meister, die Begegnung eines Spitzels nach dem Verlassen einer illegalen Versammlung, – nimmt einen bösartigen Charakter an. Der Genosse – ein Ausländer, belastet mit Familie, die Hälfte der Woche ohne Arbeit längst, als Kommunist bekannt, – er fühlte deutlich, daß er jeden Augenblick mit seinen sechs Gören unters Rad geraten kann. Sie sind alle furchtbar ermüdet, entsetzlich ausgehungert, wie erkaltet.
Es waren schwere Kämpfe. Aber der Oktober hat den Sieg nicht gegeben, an den Schiffbek, dieses Verdun des Hamburger Aufstandes, so fanatisch geglaubt hat. Der Polizei ist es nicht gelungen, den Genossen, der an der Bewegung den regsten Anteil nahm, zu ergreifen.
Er schickte seiner Frau aus dem Auslande einen Brief.
Alles in seiner Wohnung atmete auf, wurde still und ruhig, sprach mit leiser Stimme.
Der Brief aus dem Auslande – war wie das Aufschlagen einer fernen Schaufel, die diese fünf Menschen, die wie von einem Bergsturz verschüttet waren, herausgrub.
HAMM
VII.
Das Stadtviertel Hamm. Der Lage seiner geraden, breiten Straße nach, eignet sich diese Vorstadt sehr wenig für Straßenkämpfe. Seine öden Alleen lassen sich sehr schwer mit einem Barrikadengürtel zusammenziehen. Glatte, nackte Fassaden der Arbeiterkasernen fallen steil ab auf den spiegelglatten Asphalt. Die Mauern geben einzelnen Schützen keinerlei Deckung; die Kämpfer brauchen Nischen, Vorsprünge, vorstehende Treppen, altmodische Häuser. Spaten und Spitzhacke würden sich die Zähne brechen, wenn sie versuchen wollten, den festgewalzten Mörtel aufzureißen. Um eine solche Straße zu verschließen, muß man einige große Bäume fällen, aber es gibt nicht viel Bäume in diesem Viertel der Armut.
Außerdem lassen sich die Straßen von Hamm sehr leicht mit einem Maschinengewehr beherrschen, das an einer Straßenkreuzung aufgestellt ist: die entblößte Flucht der Steinkorridore gibt dem Feldstecher jede zusammengekauerte Figur preis, die im kalten Schatten dieser unmenschlichen Fassaden Deckung suchen wollte, jede Gestalt mit einer auf die Augen geschobenen Mütze, mit einem wollenen um den Hals gewickelten Tuch und einem Gewehr in der Hand wäre hier ausgeliefert.
Alle diese ungünstigen Besonderheiten konnten nicht verhindern, daß Hamm zum Schauplatz von kurzen aber sehr gespannten Kämpfen wurde. Sogar der gemischte kleinbürgerliche Charakter der Bevölkerung vermochte sie nicht zu schwächen. Die vorwiegend hier wohnenden Studenten boten ihre Dienste geschlossen der Polizei an, – aber nicht hier, bei sich zu Hause, sondern in anderen, sichereren Stadtteilen.
Ein bewaffneter Aufstand setzt das Vorhandensein von Menschen voraus, die über Waffen verfügen. Der Hamburger Aufstand war ein Aufstand von unbewaffneten Arbeitern, die vor allem die Aufgabe hatten, sich auf Kosten ihres Gegners zu bewaffnen.
Im Bezirk Hamm gibt es fünf Polizeireviere, die stets von Sipo-Abteilungen besetzt sind; außer den Waffen, die die Schutzleute in der Hand haben, hofften die Arbeiter in jedem dieser Reviere kleine Arsenale vorzufinden.
Also in Hamm, wie in allen anderen Stadtteilen, begann der Kampf mit dem Angriff der Arbeiter auf die kleinen Polizeifestungen, die von Posten bewacht und mit Personal und Munition aller Art überfüllt waren.
Eines der schwierigsten Reviere wurde von zwölf Arbeitern, die nur über eine altmodische Pistole verfügten, genommen.
Dicht vor der Tür des Polizeibüros schien der Arbeitertrupp ein wenig unsicher zu werden. Da rief einer der Genossen, – seinen Leuten zu:
„Nun man los!“ Und ohne hinzusehen, ob die anderen ihm folgten, mit großen Sätzen über die Treppe fliegend, brach er ins Revier ein. Hinter ihm – sein Freund, ein junger Mensch – sonst niemand. Der einzige und nicht einmal geladene Revolver richtete sich auf den Sipohaufen. Er bemerkte die Unentschlossenheit der Gegner, brüllte wild auf und schlug nicht mißzuverstehend, mit der Faust auf den Tisch. Die Papiere flogen auf den Boden, das heilige Naß der Tintenfässer ergoß sich über den Tisch, – die Staatsgewalt begann zu wanken.
„Man los, hier wird nicht lange gefackelt!“
Die Polizei ergab sich, hob die Hände, wurde entwaffnet und von den hinzueilenden Genossen in ein Zimmer eingeschlossen. Was sollte jetzt geschehen? Sollte man sich in dem besetzten Revier verschanzen. Oder hinausgehen. Schützengräben graben, Barmbeck zu Hilfe eilen, von wo unaufhörliches Gewehrgeknatter herübertönte? Man hatte indes keinerlei Verbindung mit der Leitung.
Y. pflegte in den Parteiversammlungen in irgendeiner Ecke schweigend an seiner Pfeife zu saugen, im Schatten seiner wasserdichten, höckrigen Kleidung des Löscharbeiters. Er schwatzte niemals, er haßte die Phrasen mit einem Schwall blitzender Worte, mit pathetischen Aufrufen zum Kampf, – wie sie die Partei-Intellektuellen zum Besten geben. Er stellte sich den Aufstand als etwas Einfaches, Gradliniges, ohne die geringste Abweichung und ohne jede Schwankung vor, – wie den Aufschwung eines Hebekrans, der seine Beute erfaßt hat, wie die untadelhafte Geradheit eines Kompaßpfeils. – Und da er keinerlei Direktiven erhielt, lud er sein Gewehr, legte die Patronen in bequem erreichbaren Häuflein zurecht und bereitete sich vor, am Fenster, dessen Vorsprung ihm eine gewisse Deckung gewährte, zu kämpfen und zu sterben.
Vergeblich suchten ihn die Genossen zu überreden, das Haus zu verlassen, – sie bewiesen ihm die Gefahr seiner Stellung, die jeden Augenblick umringt und abgeschnitten werden konnte. Er beschloß zu bleiben.
„Dat is Befehl, ick bliew!“3 und er blieb. – Eine Stunde später begann der Zweikampf dieses Mannes mit der Polizei, die das ganze Viertel überschwemmte. Nachdem er seinen letzten Schuß abgegeben hatte, brach er endlich zusammen, – verwundet am Kopf, an Brust und Bauch; der furchtbare Schlag eines Stiefelabsatzes nahm ihm das Bewußtsein.
Er starb nicht im Krankenhaus, wo man aus seinem Körper sechs Kugeln herausholte. Von dem schnellen Sieg der Revolution überzeugt, lehnte er es ab, zu fliehen und akzeptierte lächelnd die zehn Jahre Zuchthaus, zu denen ihn Scheidemann „begnadigt“ hatte. Als er den Gerichtssal verließ, wandte er sich zu der Menge um und rief seinen Freunden zu, die unter dem bürgerlichen Publikum verstreut saßen:
Haltet meinen Revolver in Ordnung, ich werde ihn mir bald holen!“
So verlief die Einnahme des Polizeireviers in der Festungstraße.
Gegen 7 Uhr morgens begann es hell zu werden. Der Straßenverkehr ruhte (in diesem Stadtteil ruht er allerdings nur wenige Stunden), Abteilungen von bewaffneten Arbeitern hielten ihre Kameraden, die nichtsahnend zur Arbeit gingen, an und schickten sie nach Hause zurück.
„Was ist geschehen?“
„Die Diktatur des Proletariats ist erklärt.“
„Dat kun ja ook nich’ so wieder gohn.“4
„Denn got wi werra nochus“.5
Nicht auf die Barrikaden, nicht den Arbeiter-Hundertschaften zu Hilfe, sondern nach Hause.
Auch das ist charakteristisch.
Die meisten Aufständischen ließen trotz des Fehlens aller Befehle seitens des Stabes die ausgeplünderten Reviere im Stich und rückten nach Barmbeck aus, wo die wilde Schießerei keine Sekunde aufhörte. Sie haben instinktiv die einzig vernünftige Taktik gewählt. Der Asphalt läßt sich nicht heben. Bäume gibt es fast gar nicht. Zu wenig Waffen, um breitere Massen in Bewegung zu setzen, – deshalb zerstreuten sich bewaffnete Gruppen nach allen Seiten, um einzeln in die kämpfenden Stadtviertel zu gelangen. Die Abteilung Y.’, Z.’s (insgesamt neun Gewehre und zwölf Revolver), schlug die Richtung nach dem schärfsten Kampfe ein. In einem der Steinkorridore begegneten sie dem Maschinengewehrfeuer eines Lastautos. Die Schützen fielen zu Boden, um dann unter dem sich nähernden Feuer in einer Seitengasse Deckung zu suchen. Einer der Genossen erhob sich aufs Knie, hob das Gewehr an die Schulter – in der nächsten Sekunde entfiel es seinen Händen. Y. erinnert sich, wie eine Blutrinne vom Trottoir dem Gully zufloß und einen von irgend jemand hingeworfenen Zigerettenstummel mit sich forttrug. Seitwärts ertönte das Dröhnen eines zweiten Wagens. Ohne die Aufständischen zu bemerken, nahm er am Ende der Gasse eine bequeme Stellung ein und drehte ihnen seine ungeschützte Seite zu. Die Aufständischen leerten den Wagen buchstäblich mit ihrem Feuer. Da nahm die kleine Abteilung die Form eines beweglichen Karrees an, das während vieler Stunden sich kämpfend vorschob und endlich eine wirkliche Schlacht auf der Brücke des Mittelkanals lieferte. Das war ein elastisches Quadrat, das im nötigen Augenblick sich zusammenrollte und verschwand, wie Wasser im Sande. In seiner Mitte – drei, vier erstklassige Scharfschützen. Sie besetzten einen Kreuzweg – das zentrale Glied von einigen größeren Straßen. An allen nächsten Ecken, geschützt von Litfaßsäulen, Baumstämmen, Telephonhäuschen placieren sich die mit Revolver bewaffneten Posten. Sie schießen nur aus nächster Entfernung, nur bei einem Handgemenge und sie warnen die Scharfschützen, wenn ihnen eine Umzüngelung droht. Sich von Straße zu Straße weiterschiebend, immer neue Knotenpunkte verteidigend und aufgebend, setzte sich die Abteilung endlich an der Brücke des Mittelkanals fest, dem, einem breiten Fächer gleich, die steinernen Falten der umliegenden Straßen zustreben. Die Brücke krümmt ein wenig ihren breiten Rücken, um wie angeekelt den Strom des trübe schimmernden Fabrikwassers zu überschreiten. Die Schützen legen sich so nieder, daß nur die Mündung ihrer Gewehre über ihre Krümmung hervor sehen. Einige aus einem viel zu weiten Korsett aus Eisenstäben hervorgewachsene elende Bäume, die diesen öden Platz nur deshalb nicht verlassen haben, weil der Beton ihre unmündigen Wurzeln gepackt hält, – bilden nebst einem schwindsüchtigen Laternenpfahl die einzige Deckung der Kämpfer, die links und rechts von den drei besten Scharfschützen Aufstellung nehmen.
Längs des ganzen Ufers ziehen sich unbewohnte finstere Gebäude hin. Nur selten zeigt sich in ihrer feuchten Mauer ein Kellerfenster. Es erscheint wie ein krampfhaft aufgesperrtes Maul, das aus dem Wasser aufgetaucht ist, um einen Atemzug zu machen und sofort wieder zu verschwinden.
Es ist ein Arbeits-Venedig. Aber seine Baumwolle, Fett und Eisen bergenden Paläste kennen keine breiten Marmortreppen und Kais; Ziegelsteine und Beton, vom giftigen Abflußwasser bespült, sind mit einem Anflug fürstlicher Schönheit bedeckt, mit blaßgrünem, grauem und rosa-rostigem Schimmer, der vielfältiger und wundersamer ist als Porphyr, Marmor und Malachit des großen Quattrocento. Funkelnde Kohle veredelt die graue Stumpfheit der Steinschluchten. Diese, das industrielle Harnburg umspülende Lagune kennt keine Gondeln, keine romantischen Nächte. Sie trägt den Unrat der Fabriken, Feuchtigkeit, Kälte und alle Krankheiten in das Meer, die durch ihre Mauern in das Leben, in den Schlaf, in die Arbeit und ins Blut von Millionen Arbeitern sickern. Wie die Doggen blicken Fabrikschornsteine in die trüben Spiegel. Rauch flutet von ihren Schultern, majestätischen Mänteln gleich, und es ist nicht der goldene Ring der Adria, der sie mit ihrem grauen, kalten und beschmutzten Meer vermählt, sondern – das Geheul der Schiffssirenen, die die Ankunft der kostbaren Rohstoffe verkünden. Die Nereiden sind im kalten Schmutz der Kanäle schon längst ausgestorben. Zuweilen finden Straßenjungen im Wasser ihren weißen Fischleichnam, der mit dem weißen Bauch nach oben, mit qualvoll aufgesperrten Kiemen umherschwimmt.
An diesem Kanal wurde gekämpft. Auf einmal melden die Vorposten: Automobile. Man mußte die Stellung wieder ändern. Wieder – Scharfschützen im Zentrum des Karrees, Posten an den Ecken. Ein Lastauto, vollgepfropft mit Soldaten springt unerwartet hinter der Ecke hervor. Mit einem Schuß gelingt es Y. den Motor zu verletzen. Die Sipo läßt das Auto im Stich, trägt ihre Verwundeten fort. Der Trupp macht wieder einen verzweifelten Sprung und besetzt den Knoten des Nachbarviertels. Dieses Mal wird er von einem Panzerwagen attackiert, unter dessen Deckung sich eine Kette von Grünen aufrollt. Die Aufständischen schießen den Leutnant nieder – einen tapferen, aber dummen Leutnant, der mutig hervorspringt und mit lauter Stimme seine Leute zum Angriff anfeuert. Unter der Sipo verbreitet sich eine Panik. Dann tritt Totenstille ein, eine Stille, die dem gespenstischen Reich der unbewohnten, von Bannern des Fabrikrauchs und entfernten Salven des Aufstandes umwehten Kanälen überhaupt eigentümlich ist. Durch menschenleere Straßen, an stillstehenden, glasigen Flüssen vorbei, an regungslosen, wie Klöster versperrten Fabriken und Häusern mit feindselig verschlossenem Munde entlang – fuhren die Aufständischen fort, sich weiterzubewegen, ihre Kampfordnung an den Kreuzungen umzuformen. Wieder ein Dröhnen der Räder auf dem ausgestorbenen Pflaster. Diesmal nur ein Wagen, beladen mit Zeitungen. Die Gefahr vergessend, in den festgebundenen Zeitungsbündeln, dann in den frischen Blättern des „Fremdenblattes“ wühlend – suchten sie und konnten nicht finden, jene einzigen Worte, auf die sie den ganzen Tag über gewartet, qualvoller gewartet haben, als auf die Nachricht ihres eigenen Sieges: – auf die Nachricht von einer deutschen Revolution, von einer Sowjet-Republik in Deutschland. Y. warf fluchend die Zeitung beiseite und ergriff eine neue. Z. las und wurde weiß im Gesicht. Einer weigerte sich, dem gedruckten Worte zu glauben und verband seinen verwundeten Unterarm mit dem schmutzigen Papier; er schüttelte verächtlich den Kopf: versteht sich, die Zeitung log. Sie verschwieg absichtlich den sieghaften Aufstand in Berlin, Sachsen und überall. Es war ja gar nicht anders möglich!
Dann warf man die Zeitungsbündel auf den Asphalt und zündete sie an. Der Wind ergriff die flammenden Blätter und trug sie in die Kanäle. Dort schwammen sie wie brennende Vögel, wie flammende Schwäne.
Aus den Nachbarstraßen knallten Salven. Im Schein des riesigen Feuers, das die Soldaten vergeblich zu löschen versuchten, zog sich der Trupp Aufständischer langsam zurück.